
|
|
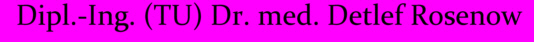
|
|
Die Geschichte der operativen Behandlung der Trigeminusneuralgie
Einleitung: Ausführliche Darstellungen der Geschichte der Behandlung Trigeminusneuralgie (TGN) finden sich bei Schuh (1858), Horsley (1891), Rose (1892), Krause (1896), Sjöqvist (1957), Stookey (1959) sowie eine neuere, umfassende Übersichtsdarstellung von Rovit et al. (1990).
Begriffliche Entwicklung: Galen (lat.: Claudius Galenus, 129-199 n.Chr.) beschrieb als Erster die Dreiaststruktur des N. trigeminus, Avicenna (9. Jhdt. n. Chr.) einen paroxysmalen Gesichtsschmerz, Jurjani (11. Jhdt.) die Trigeminusneuralgie. Falloppio (1561) beschrieb den N. trigeminus als eigenständigen Nerv, der Pariser Chirurg Nicholas André (1756) prägte den Terminus „tic douloureux“ und John Fothergill (1769 und 1773) das klinische Gesamtbild der TGN. Terminologische Unschärfen wie die Einteilung der TGN in „major“ (tic douloureux) und „minor“ (atypischer Gesichtsschmerz) sind heute obsolet. Lange Zeit wurde die TGN auch als Fothergill´sche Krankheit bezeichnet (Sjöqvist, 1957). „Tic douloureux“ ist heute eine immer noch allgemein akzeptierte Bezeichnung für die typischen Schmerzattacken der symptomatischen Trigeminusneuralgie.
Trigeminusschmerzen, die als Folge von Verletzungen von Trigeminusästen entstehen (z.B. die Anaesthesia dolorosa), werden heute zur besseren Abgrenzung Trigemninusneuropathie genannt.
Eine Sonderstellung nimmt dabei der bilaterale Trigeminusschmerz demyelinisierender Ursache (z.B. Encephalomyelitis disseminata) ein. Er besitzt die typische Charakteristik des tic douloureux, ist aber ein Schmerz ausgehend von den Trigeminuskernen im Pons.

- Pujol (1787)

- Keen & Spiller (1897)
Periphere Neurotomien
Galen wird zugeschrieben, Neurektomien an den peripheren Nervenästen zur Behandlung der TGN als Erster vorgeschlagen zu haben (Rose, 1892). Erst Anfang des 18. Jahrhunderts, machte der Leidener Anatom Bernhard Siegfried Albinus gleichgerichtete Vorschläge (Rose, 1892). Der französische Hofchirurg Maréchal soll 1730 als Erster erfolglos eine Neurotomie des N. infraorbitalis versucht haben (zit. Sweet, 1985).
Derartige destruierende chirurgische Eingriffe wurden bis weit in das 19. Jahrhundert auch in Deutschland vorgenommen.
Pancoast and Woodbury beschrieben 1872 eine OP-Technik um den 3. Ast im Bereich des Foramen ovale, also an der Schädelbasis, zu erreichen (Sweet, 1985), Krönlein (1884) erweiterte diesen Eingriff unter Beteiligung der Äste 2 und 3 und berichtete über die sensiblen Ausfälle der so behandelten Patienten.
Periphere Neurektomien/Exhairesen
Der Franzose Blum publizierte 1882 als Erster einen Fall einer Exhairese des N. infraorbitalis (Sweet, 1985), eine umfassendere Darstellung seiner Erfahrungen mittels Exhairese liefert uns Thiersch, der sogar spezielle chirurgische Werkzeuge zur möglichst ausgedehnten Exhairese entwickelte (Krause, 1907).
Ganglionektomien
Der erste Eingriffe dieser Art, dessen Ziel die Teilentfernung des Ganglion gasseri war, wurde von Rose transmaxillär, und von Horsley transzygomatisch durchgeführt. Rose berichtete über eine Serie von 5 Patienten, die nach diesem Eingriff sämtlich schmerzfrei waren (Horsley, 1891, Rose, 1892). Der Zugang war sehr umständlich, er wurde quasi frontolateral durchgeführt, um eine Berührung des Gehirnes zu vermeiden.Hartley, am 15.08.1891, und Krause am 23.02.1892, haben unabhängig voneinander einen einfacheren und direkten, streng lateralen Weg zum Ganglion durch die Squama temporalis und mittels extraduraler Elevation des Temporallappens beschrieben (Hartley, 1892; Krause, 1892, Carmel u. Buchfelder, 1993). Sie resezierten zunächst nur jeweils den zweiten und dritten Ast des Trigeminus. Krause erweiterte jedoch bereits bei seiner zweiten derartigen Operation den Eingriff, in dem er das komplette Ganglion Gasseri entfernte. Dieser Eingriff oder Modifikationen dieser Technik hatten für Jahrzehnte in der Neurochirurgie Standardcharakter zur Behandlung der TGN. Horsley schlug den Terminus „Hartley-Krause-approach“ für diesen Zugang vor (Sweet, 1985, Carmel, 1993). Die Mortalität, die anfangs noch sehr hoch war (ca. 10%) konnte von Cushing, der noch basaler und frontolateraler als Krause und Hartley das Ganglion darstellte, so die A. meningea media belassen und andererseits auf eine Retraktion des Temporallapens verzichten konnte, auf 2 Todesfälle bei 332 Ganglionektomien reduziert werden (Sweet, 1985).Spiller publizierte gemeinsam mit Frazier (1901) eine neue Technik, bei der eine retroganglionäre Trigeminotomie durchgeführt wurde unter gleichzeitigem Erhalt der motorischen Fasern des Trigeminus (Spiller, 1901). Es war bereits damals bekannt, dass es bei Patienten mit durchtrenntem V/1-Ast oft zu einer Keratitis neuroparalytica mit den bekannten Gefahren kommen konnte. Frazier hatte seine selektive Technik weiterentwickelt und erstmals 1925 bei einem Patienten die retroganglionären Anteile des ersten Astes und der motorischen Fasern belassen (Sweet, 1985).
Parapontine Rhizotomie
Dieffenbach erwog bereits 1845 nach eigener erfolgloser Neurotomie des N. infraorbitalis eine intrakranielle Neurotomie des N. trigeminus (Sjöqvist, 1957). Dandy führte diese Technik als Erster durch. Über einen subokzipitalen Zugang wurde in der hinteren Schädelgrube der sensible Anteil der Trigeminuswurzel, also etwa die oberen 50-60 Prozent der Wurzel, durchtrennt (Dandy, 1925). Zwar hatte Dandy später umfassend über die Vorteile der partiellen Rhizotomie geschrieben (Dandy, 1929), in seinen letzten Jahren lehnte er aber subtotale Rhizotomien wegen des aus seiner Sicht zu hohen Rezidivrisikos von ca. 10% (!) ab (White u. Sweet, 1955).

Chemoneurolytische Verfahren
André versuchte 1732 an einer von Maréchal erfolglos an TGN behandelten Patientin (s.o.) eine chemoneurolytische Therapie, indem er einn Ätzstein auf den Nerven am Austrittspunkt für 10-12 Tage beließ und damit erfolgreich war. Die Patientin war danach für 18 Monate schmerzfrei.1902 begann der Münchner Augenarzt Schlösser (Schlösser, 1907) bei einem erfolglos ausbehandelten Patienten mit „Fazialisclonus“ sowie danach bei Patienten mit neuralgischen Gesichts- und Kopfschmerzen 0,5-4 ml 70-80%igem Alkohol durch verschiedene Punktionstechniken Neurolysen durchgeführt, wobei mehr als die Hälfte der Patienten (123/209) an Trigeminusneuralgie litt.Im Bereich des Ganglion Gasseri wurde Alkohol zunächst noch nicht perkutan appliziert, sondern er wurde additiv nach operativer Freilegung auf das Ganglion aufgebracht (Rovit, 1990).Harris (1909) befasste sich mit einer Technik, bei der auf perkutanem Wege Alkohol ins Cavum Meckeli eingebracht wurde. Er wandte diese erstmals an Patienten 1910 an (Rovit 1990).
Der bei Bier in Berlin als Assistent tätige Härtel publizierte 1911 eine ähnliche Technik wie Harris, er injizierte jedoch zunächst Procain statt Alkohol mit dem Ziel, Operationen am Kopf ohne Vollnarkose vornehmen zu können (Härtel, 1911). In späteren, umfassenderen Publikationen zu diesem Thema (Härtel 1912, 1913) zielte er dann auf die symptomatische Behandlung der TGN ab. Bahnbrechend war jedoch die freihändig geführte perkutane Punktion des Ganglion Gasseri durch das Foramen ovale, eine Punktionstechnik, die bis heute unverändert angewendet wird (Härtel, 1913; Sweet, 1975).
Die Rezidivquote bei alkoholischer Gangliolyse lag bei 20% im ersten postoperativen Jahr.Håkanson, ein Schüler Leksells, hatte 1975 im Rahmen der stereotaktisch geführten Gammabestrahlung des Ganglion Gasseri bei TGN Glycerin als Trägerlösung für den Tantalstaub benutzt, um so diese radioaktiv markierte Substanz in das Cavum Meckeli zu bringen. Seine Patienten waren bereits kurz nach der Instillation schmerzfrei ohne Verlust sensibler Qualitäten (Sweet, 1985); so behandelte er auf diese Weise insgesamt 75 TGN-Patienten, mit einer Erfolgsquote von ca. 86%. Ca. 0,3 ml Glycerin über den Härtel´schen Zugang in das Cavum Meckeli eingebracht, reichten für diesen klinischen Effekt aus (Håkanson, 1981). Ein Vorteil gegenüber den anderen gangliolytischen Verfahren lag vor allem in der geringeren Toxizität des Glycerins gegenüber dem Alkohol (Glycerin ist ca. 20 Prozent schwerer als Liquor, Alkohol 20% leichter).
An den Aussagen, dass die Patienten postinterventionell weder ein sensibles Defizit noch schmerzhafte Dysaesthesien oder gar eine Anaesthesia dolorosa (ein von Olivecrona geprägter Begriff) als mögliche persistierende Folgezustände boten, muß anhand der vorliegenden Langzeitergebnisse (s.u.) gezweifelt werden. Sweet war von der Methode so angetan, dass er sogar Vorteile gegenüber der von ihm inaugurierten Methode der kontrollierten perkutanen Thermorhizotomie sah (Sweet, 1981). Diese Methode bei TGN wurde in Deutschland als Therapieschwerpunkt vor allem in Göttingen und Hamburg-Eppendorf betrieben.
Langzeitergebnisse dieser Technik an 80 Patienten mit Beobachtungszeiträumen zwischen 38 und 54 Monaten widersprechen den oben genannten Vorteilen erheblich: die Rezidivrate lag nach 54 Monaten bei 72%, die Dauer der Schmerzfreiheit lag im Mittel bei 32 Monaten. Auch die Komplikationsrate war bemerkenswert: 63% der Patienten hatten definitive Hypästhesie der betroffenen Gesichtshälfte, 29% unangenehme Dysästhesien, davon 2 Patienten mit Anaesthesia dolorosa (Fujimaki, 1990). Langzeituntersuchungen von Lunsford (1990) über 90 Monate an 376 Patienten ergaben Rezidivquoten bis 15%. In ca. 30% fand er definitive Sensibilitätsverluste, die über 50% nach der zweiten und bis ca. 70% nach der dritten Glycerin-Injektion zunahmen. In der Diskussion seines Beitrages bezieht sich Lunsford auf die Dieckmann´schen Ergebnisse (Dieckmann, 1987) und findet, dass dessen Ergebnisse mit deutlich niedrigerem Risiko eines Sensibilitätsverlusts anhand seiner Daten nicht nachvollziehbar sind. Die Ergebnisse von Fujimaki und Lunsford bzgl. der Glycerin-Rhizotomie können bei der Bewertung dieser Methode nicht unberücksichtigt bleiben und geben keinen Anlaß, dieser Methode gegenüber der Thermorhizotomie den Vorzug zu geben. Rezidivquoten und potentielle OP-Folgen sind mit denen des Sweet´schen Verfahrens vergleichbar.
Jaeger hatte 1955 erstmals über eine neue Methode zur Behandlung der TGN berichtet, bei der er ca. 75°C heißes Wasser ins Cavum Meckeli einbrachte. Er berichtete 1958 im Rahmen eines Vortrages über diese Methode, die zwischen 1953 und 1958 an 185 Patienten angewendet worden war. Bis auf 7 Patienten sollen alle schmerzfrei gewesen sein (Jaeger, 1959). Weitere Publikationen zu dieser Methode existieren nicht.

- OP-Technik nach Sweet
Stereotaktische Methoden
Lars Leksell´s (1951) erster Eingriff überhaupt mit Gammastrahlen galt der Behandlung der Trigeminusneuralgie (Leksell, 1951). Riechert und Hassler (1959) haben bei TGN Thalamotomien durchgeführt, sämtliche stereotaktischen Verfahren wurden aber wegen erheblicher unerwünschter Folgeerscheinungen (Déjerine-Roussy-Syndrom) verlassen, zudem hatten diese Methoden eine Rezidivquote von ca. 50% (Schürmann u. Butz, 1968).
Spiegel und Wycis (1966) berichteten über 8 Patienten mit atypischem Gesichtsschmerz, bei denen sie stereotaktisch geführte Mesencephalotomien unter Beteiligung des Tractus spinothalamicus und der dorsal des Ncl. ruber liegenden Anteile der Formatio reticularis vorgenommen haben. Die Rezidivrate betrug ca. 70%.
Allein die Bestrahlung des Ganglion Gasseri und der Trigeminuswurzel mittels eines Gammastrahlers (heute Gammaknife genannt) ist seit Beginn der 90er Jahre, wohl auch im Zusammenhang mit einer gewissen Gammermesser-Euphorie zur Behandlung anderer Erkrankungen wie z.B. intrazerebraler Angiome, Akusticusschwannome, wieder ins Gespräch gekommen. Kondziolka (1995) berichtete über seine Serie von 25 in drei Zentren behandelten Patienten, die sämtlich wegen der TGN bis zu 7 mal voroperiert waren, u.a. auch noch teilweise mit Methoden wie Rhizotomie und peripherer Neurektomie (noch in den 90er Jahren !!).
Es ist hier methodenimmanent, dass ein Sistieren der TGN nicht sofort einsetzen kann, die Latenz betrug zwischen einem Tag und 6 Wochen. Am Ende des Beobachtungszeitraumes (1-17 Monate) waren 24% Therapieversager, d.h. in der Größenordnung der ablativen Verfahren. Als effektivste Isodosis hatten sich 70 Gy ergeben.
Pollock et al. (2000) berichteten über 23 Patienten mit tumoröser Trigeminusneuropathie. 50% der Patienten waren initial schmerzfrei, 46% berichteten über deutliche Schmerzlinderung. Innerhalb des Nachuntersuchungszeitraumes von 1-9 Monaten ergaben sich 3 Rezidive, entsprechend ca. 13%.
Kondziolka et al. (2000) untersuchten die histologischen Effekte der radiochirurgischen Methode an einem Tiermodell und fanden eine axonale Degeneration (Waller´sche Degeneration) bei 80 Gy, höhere Dosen bewirkten eine Nekrose. Dennoch sollte auf Grund der Erfahrungen, die mit der Bestrahlung z.B. von Hypophysentumoren gesammelt wurden, die Behandlung der TGN mittels Gammamesser nicht unkritisch gesehen werden: Fragen zu Langzeitschäden (Strahlenenzephalopathie) können noch nicht beantwortet werden, da diese erfahrungsgemäß erst ca. 10 Jahre nach der Bestrahlung auftreten.
Elektrophysikalische Methoden
Der Heidelberger Chirurg Martin Kirschner entwickelte 1931 die Methode der perkutanen Elektrokoagulation des Ganglion Gasseri. Er entwickelte diese weiter und schob mittels eines eigens konstruierten stereotaktischen Zielgerätes, das am Kopf befestigt wurde, eine nur an der Spitze unisolierte Elektrostahlnadel über die anatomischen Koordinaten des Härtel´schen Zugangs bis ins Ganglion Gasseri vor (1933) und konnte so im ersten Versuch in 90/100 der behandelten Patienten die Nadel durch das Foramen ovale bringen (Kirschner, 1936).
Tönnis und Kreissel (1951) sahen vor allem das hohe Risiko irreversibler Augenschädigung als wichtigstes Argument gegen diese Methode; Verbesserungen (z.B. Minderung der angelegten Spannung) wurden durchgeführt, dennoch hat sich diese Methode z.B. in Großbritannien, den USA und in den Scandinavischen Ländern nie durchgesetzt (Sjöqvist, 1957). Hauptursache für die Nichtakzeptanz war die relativ hohe Mortalität der Kirschner´schen Technik.
Schürmann u. Butz (1968, 1972) verglichen die Methode der 2/3-retroganglionären Trigeminuswurzelresektion mit der Kirschner´schen Technik anhand hoher Patientenzahlen (531 bis 1972) und schlussfolgerten, dass sich mit einer modifizierten Technik, d.h., fraktionierte Thermodenervation, die besten Ergebnisse im Vergleich zur ablativen Methode der Rhizotomie erzielen lassen. Die Rezidivrate konnte so auf 2% reduziert werden. Sweet sah das technische Potential dieser Methode und entwickelte ab 1965 eine Modifikation dieser Technik: er benutzte eine bis auf die Spitze isolierte normale 20G-Spinalnadel, führte sie nach der Härtel´schen Punktionstechnik unter C-Bogen-Kontrolle bis ins Cavum Meckeli und kontrollierte die korrekte Lage anhand elektrophysiologischer Parameter.
Mittels eines Thermistors (von engl.: therm(o)resistor, einem elektrischen Widerstand, dessen Ohm-Werte mit zunehmender Temperatur abnehmen) wurde der Patient unter kurzer Barbituratnarkose temperaturkontrolliert und zeitfraktioniert thermodenerviert (Sweet, 1985). Diese Technik hat bis heute ihren Stellenwert behalten, wird aber zugunsten der MVD, auch bei Patienten mit ASA-Stadium über II, heute immer seltener durchgeführt. Penzholz (1975) stellte auf der 26. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie in Heidelberg die Ergebnisse einer kooperativen Studie von 17 deutschen und österreichischen Kliniken vor, in der 1946 Patienten über 10 Jahre mit folgenden neuroablativen Verfahren behandelt wurden:
Kirschner: n=971; Alkoholinjektionen: n=80; Frazier: n=370; Dandy: n=107; Sjöqvist: n=55.
Alle Verfahren brachten eine initiale Schmerzbefreiung in 50% der Fälle, die Komplikationsrate war bei der Elektrokoagulation am niedrigsten, sie war doppelt so hoch bei der Frazier´schen Technik und viereinhalb mal so hoch nach Dandy-Technik. Die Rezidivrate betrug bei Kirschner 40%, bei Frazier 16,5% sowie bei Dandy 7,5% (Dandy´s eigene Zahl: 10%). Die Mortalität lag bei Kirschner: 0,5%, Frazier: 2,6% und Dandy: 6,6%. Penzholz folgerte, dass zum damaligen Zeitpunkt die Kirschner´sche Technik die beste Methode zur Behandlung der damals noch „idiopathisch“ genannten TGN sei. Die Schlußfolgerung war dabei identisch mit der von Schürmann (1968, 1972).

- Originalbedienungsanleitung mit Beispielfotos Kirschners Zielapparat der Fa. Erbe, Tübingen aus dem Jahre 1931.
Hirnstammeingriffe
Serra berichtete von einer Patientin, die an einer tumorösen Gesichtsneuralgie unter Beteiligung des Plexus cervicalis/brachialis litt. Der Gesichtsschmerz war nach der Hartley-Krause´schen OP verschwunden, es bestanden noch Schmerzen im oberen Plexus brachialis. Über einen subokzipitalen Zugang wurden schließlich die sensiblen Trigeminuskerne sowie das Wallenberg´sche Bündel im Pons Varoli mittels einer Elektrode denerviert. Postoperativ soll die Patientin Schmerzfreiheit in den Wurzeln C2-5 angegeben haben (Serra, 1936). Diese Methode hat keine Bedeutung gewonnen.
Andere Eingriffe im Bereich des Hirnstamms waren z.B. die hohe Brückentraktotomie (Dogliotti, 1938) und die Mesenzephalotomie (Walker, 1942). Ersterer Eingriff ist nur von Dogliotti selbst durchgeführt worden und hat keine Bedeutung gehabt, letzterer wurde von Walker mehrfach durchgeführt und schließlich deswegen verlassen, weil die negativen Folgen des Eingriffs (Anopsien, zentrale Hörstörungen, schmerzhafte Dysästhesien (50% der Fälle) den ursprünglichen tic douloureux bei weitem überwogen (Schürmann u. Butz, 1968).
Medulläre Traktotomie
Im Rahmen einer ausführlichen Literaturrecherche für seine Dissertation hatte Sjöqvist (1937, 1938) einen Artikel von Hun (Sjöqvist, 1937, 1938) gelesen, der den Fall der Obduktion eines Patienten mit PICA-Verschluss und Infarzierung der medullolateralen Abschnitte bis zur Mitte der Olive beschrieb. Dieser Patient gab zu Lebzeiten völlige Anästhesie der ipsilateralen Gesichtshälfte bei erhaltener Berührungsempfindlichkeit an. Auf der Basis dieser Beobachtung operierte Sjöqvist 9 Patienten und führte bei diesen eine Durchtrennung des Tractus spinalis nervi trigemini ca. 8-10 mm unterhalb des Obex durch. Sweet fand, daß dieser Trakt zusätzlich auch nozizeptive Afferenzen des N. intermedius, des N. glossopharyngeus und der oberen vagalen Anteile erhielt (White and Sweet, 1969). Eine Durchtrennung in Höhe des Unterrandes des Obex führte zur vollständigen Schmerzfreiheit im sensiblen Versorgungsgebiet der Nn V, VII (N. intermedius) und IX, sowie X. Eine derartige Ausdehnung der Kerne war bereits von Cajal an der Katze (1909) beschrieben worden (White and Sweet, 1969). Sweet sah eine Indikation dieser Methode bei Patienten mit Karzinomschmerz im Kopfbereich, denen damals keine vernünftige anderweitige Schmerztherapie angeboten werden konnte.
Die Nebenwirkungen waren nicht unerheblich: Verlust der Schmerz- und Temperaturempfindung der kontralateralen Körperseite, ipsilateraler Verlust der Propriozeption und spinale Ataxie. Da diese Methode zudem eine relativ hohe Operationsmortalität von 5,7% und eine Rezidivquote von 20-30% hatte, fand sie keine große Verbreitung.

Hinterwurzeleintrittszone (DREZ)
Die Traktotomie hatte eine neue Beachtung gefunden, als Nashold (1981) die thermokontrollierte „Dorsal-Root-Entry-Zone“-Läsion (DREZ) bei Deafferentierungsschmerzen einführte. Die offene thermokontrollierte Hochfrequenzläsion des Tractus spinalis wurde in Deutschland aufgegriffen zur Behandlung unerträglicher Gesichtsschmerzen bei Tumoren der Schädelbasis und vereinzelt auch in Fällen einer postherpetischen Neuralgie im Versorgungsbereich des N. trigeminus angewandt.

- Taarnhoj 1952
Ganglionäre Kompression und Dekompression
Pudenz and Shelden (1952, Rovit, 1990) berichteten über eine Dekompression der peripheren Trigeminusäste 2 und 3 an den Foramina ovalia und rotundia an 10 Patienten. Grundlage dieser Technik war eine Mitteilung von Woltman an Shelden, dass er durch Dekompression des N. facialis bei Fazialis-Spasmus ein Sistieren der Beschwerden erzielt hatte. In derselben Arbeit (Shelden et al., 1955) berichteten diese über 29 Patienten, bei denen sie nach Eröffnung der Dura des Ganglion Gasseri mittels einer festen Watterolle oder eines stumpfen Dissektors Druck auf die retroganglionäre Trigeminuswurzel ausübten. Die Patienten waren sämtlich beschwerdefrei, nur 2 Patienten hatten persistierende sensible Defizite. Später berichtete Shelden nochmals über die 10-Jahresergebnisse an unterdessen 200 Patienten: es wurde sofortige Schmerzfreiheit angegeben, die Rezidivrate lag bei 25% (Shelden, 1964).
Über eine völlig neue dekompressive OP-Technik des Ganglion Gasseri berichtete Taarnhøj (1952). Die Grundlage für diese OP war die Beobachtung an einem von ihm an einem Cholesteatom im Kleinhirnbrückenwinkel operierten Patienten, der gleichzeitig an einer TGN litt. Nach Entfernung des Tumors berichtete der Patient über Schmerzfreiheit, obwohl weder der Tumor noch der Operateur die Trigeminuswurzel berührt hatte (Sjöqvist, 1957). Taarnhøj folgerte aus diesem Verlauf, dass die Ursache der TGN eine Kompression der Trigeminuswurzel war, hervorgerufen durch das Ganglion Gasseri oder durch den Sinus petrosus superior. Über einen extraduralen Zugang spaltete er das Cavum Meckeli in voller Länge vom Ganglion bis zur incisura tentorii und durchtrennte den Sinus petrosus superior. Im Juli 1951 hatte er seine Serie von 12 Patienten begonnen und publiziert (Taarnhøj, 1952). Bis zu 8 Monaten postoperativ hatte er keine Rezidive beobachtet, in einer Nachuntersuchung 30 Jahre später berichtete er allerdings über eine Rezidivrate von über 40% (Taarnhøj, 1982). Diese Technik wurde zunächst von zahlreichen Neurochirurgen übernommen (Stender u. Grumme, 1968), später aber wegen der hohen Rezidivrate wieder verlassen.
Arist Stender berichtete seinerseits über eine OP-Methode bei TGN, die er zunächst „Gangliolyse“ und später „Radicolyse“ nannte (Stender, 1954, Stender u. Grumme, 1968): seit 1952 hatte er über den üblichen extraduralen Zugang die Dura propria des Ganglion Gasseri exzidiert und das Cavum Meckeli weit eröffnet: In 16 Fällen ergaben die Kontrolluntersuchungen bis zu 13 Monate postoperativ keine Rezidive. Von 115 der von 1952-1966 behandelten Patienten konnten 89 nachuntersucht werden, von denen ca. 30% ein Rezidiv hatten, ca. 50% waren völlig schmerzfrei (Stender und Grumme, 1968). Die Kombination der Gangliolyse zusammen mit Alkohol brachte eine deutliche Senkung der Rezdivrate auf ca. 10% (ohne Alkohol: 32%).
In einer umfassenden Nachuntersuchung anhand vorliegender Literatur wurden für die dekompressiven Techniken Rezidivquoten von 12-76% gefunden, wohingegen bei der Analyse der kompressiven Techniken (s.o.) vergleichsweise niedrigere Rezidivraten von 8-24% gefunden wurden, bei jeweils vergleichbaren Patientenzahlen (Stender u. Grumme, 1969).Dieser Umstand bewog Ende der 70er Jahre Mullan, mittels einfacherer, perkutaner Technik über den Härtel´schen Zugang einen Fogarty-Katheter bis ins Cavum Meckeli vorzuschieben. Er berichtete bis 1983 über 50 erfolgreich behandelter Patienten, wobei die Rezidivrate im Nachbeobachtungszeitraum von 5 Jahren mit ca. 20% angenommen wurde. In einer späteren Arbeit mit Untersuchungszeiträumen bis zu 10 Jahren konnten die vorgenannten Ergebnisse bestätigt werden. 4% der untersuchten Patienten gaben Dysaesthesien als Folge des Eingriffes ein (Lichtor, 1990). Mithin liegen diese Ergebnisse in den Größenordnungen anderer dekompressiver Verfahren.

- Dandy 1932
Mikrovaskuläre Dekompression
Historisch wurde zur Entwicklung dieser Technik eine Beobachtung von Dandy relevant: in seinem Buchbeitrag über die Behandlung der TGN beschreibt er, dass eine mögliche Ursache der Entstehung des trigeminalen tic douloureux eine arterielle Schleife sein könnte, die entweder dorsal oder ventral die sensible Trigeminuswurzel komprimiert. Dandy beschreibt in einem Zeitschriftenbeitrag erstmals ausführlich vaskuläre Kompressionen der Trigeminuswurzel (Dandy, 1929) und hält diese Beobachtungen auch fotografisch fest. In späteren Arbeiten gab Dandy in 45% von 215 behandelten Patienten vaskuläre Kompressionen an (Dandy, 1934).
Diese Beschreibungen wurden später von Gardner (1959 und 1962) wieder aufgegriffen. Gardner (1959) beseitigte die vaskuläre Kompression und polsterte die Trigeminuswurzel mit einem Gelatineschwamm. Jannetta (1967) erwähnt seine „alte“ OP-Technik, bei der er zunächst noch eine konventionelle sensible parapontine Rhizotomie mit mikrovaskulärer Dekompression durchführte (wie Dandy 1925), aber unter „mesoskopischen“ Bedingungen, also unter Zuhilfenahme eines OP-Mikroskops.
Erst 1971 führte dann Jannetta erstmals die alleinige „mikrovaskuläre Dekompression der Trigeminuswurzel“ (MVD) über den retrosigmoidalen, subokzipitalen Standardzugang durch (Jannetta, 1976). Durch die Beschreibungen dieser drei Autoren war die „idiopathische“ TGN nunmehr „symptomatisch“ geworden und konnte mittels der MVD kausal angegangen, also geheilt werden werden.
Penzholz hatte in der Heidelberger Klinik seit 1977 die OP nach Jannetta eingeführt. Anläßlich der 4. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft „Schmerz“ der DGNC 1993 in Osnabrück wurden die Patientenzahlen vorgelegt und die Langzeitergebnisse der Kliniken diskutiert: Die Effektivität dieser Methode wurde mit über 90% angegeben; sie ist mithin der Thermokoagulation in ihrer Effektivität gleichwertig, sie ist ihr jedoch hinsichtlich sekundär-neurologischer Störungen und einer Rezidivquote zwischen 9-15% deutlich überlegen.
In einer jüngeren Publikation hat Sindou die Wertigkeit der anatomischen Dekompression hervorgehoben: Ihr sei aus heutiger Sicht die absolute Priorität bei allen operativen Verfahren zu geben - sie stellt sozusagen den "Goldstandard" dar. Lediglich wenn ein Patient aus persönlichen Gründen keine Operativ wünscht, sei es gerechtfertigt, konservativ zu behandeln (Sindou 2010).
Schnittbildgebung
Auf Grund intraoperativer Befunde, die unterschiedliche anatomische Strukturen (Venen, Arterien, Briden) als ursächlich für die Trigeminusneuralgie zeigten, berichte Kress 2003 über seine Beobachtungen an der symptomatischen Trigeminuswurzel, die im Gegensatz zu der asymptomatischen, gesunden Trigeminuswurzel eine mehr oder weniger ausgeprägte Volumenminderung in der hochauflösenden MR zeigte (Kress 2003). Diese Befunde wurden später durch Andere bestätigt (Baur 2011, Lacerda Leal 2014). Insbesondere Letzterer konnte eine sehr gute Korrelation zwischen dem Ausmaß des intraoperativen Befundes, die entsprechend klassifiziert wurden, und der Volumenminderung der symptomatischen Trigeminsuwurzel in der MR herstellen.
Neuroaugmentative Verfahren
Basierend auf der Technologie der „spinal cord stimulation (SCS)“ stellte Steude (1984) ein neues Verfahren vor, bei dem er eine bipolare Elektrode an Hand der üblichen Koordinaten bis ins Cavum Meckeli vorschob und anschließend stimulierte. Diese Technik ist indiziert bei der Trigeminusneuropathie, (z.B. Anaesthesia dolorosa, Schmerzen auf dem Boden von Verletzungen des Gesichtsschädels etc.).
Vor allem bei malignen oder benignen trigeminusneuropathischen Gesichtsschmerzen bietet sich als therapeutische Alternative auch die subarachnoidale Verabreichung von Opiaten, vorzugsweise über einen ventrikulären Katheter, mittels einer Medikamentenpumpe an. Diese kann zu einer erheblichen Linderung der Beschwerden führen (persönliche Mitteilungen Rosenow und Winkelmüller).
Tsubokawa et al. wandten 1991 erstmals die präzentrale Motorcortex-Stimulation mittels Plattenelektroden bei Thalamusschmerz an (Ebel, 1996). Meyerson konnte die positiven Ergebnisse bei dieser Form des Deafferentierungsschmerzes nicht bestätigen (1993) berichtete jedoch über Schmerzfreiheit bei 75% der Patienten mit Trigeminusneuropathie. Ebel (1996) fand bei 7 Patienten mit Gesichtsanaesthesia dolorosa, Gesichtsdysästhesie oder postherpetischer Gesichtsneuralgie eine Erfolgsquote von unter 50% nach 2 Jahren.

- Ganglion gasseri (trigeminalis) - Stimulationselektrode nach Steude (Typ: Pisces Quinta Model 3981, Fa. Medtronic)
Zusammenfassung
Nach der exakten Beschreibung und Benennung dieses Krankheitsbildes vor ca. 250 Jahren belegt die Entwicklung der operativen Therapie, dass der Trigeminus die am häufigsten iatrogen traumatisierte neuronale Struktur des menschlichen Körpers ist. Es lässt sich feststellen, dass an allen anatomischen Endstrecken dieses Nerven sowie in seinem Verlauf nahezu alles operativ versucht wurde, was machbar war. Dies war nur möglich, weil die TGN in ihren Auswirkungen für die Betroffenen so quälend ist, dass die empirisch durchgeführten Methoden der ersten 250 Jahre der Therapie retrospektiv gerechtfertigt erscheinen.
Nicht nachvollziehbar ist jedoch, dass Ergebnisse fundierter Nachuntersuchungen bzgl. operativer Risiken bzw. von Rezidiven bis heute mißachtet wurden und werden. Mit der operativen Methode nach Jannetta existiert eine kausaltherapeutische Methode, die bereits jetzt nicht mehr an Altersgrenzen gebunden ist, so dass ablative Verfahren, wie die Methode nach Sweet, immer mehr in den Hintergrund gedrängt werden. Neuere augmentative Verfahren stehen zur Verfügung, um bei der Trigeminusneuropathie Anwendung zu finden.
Als palliative Methode hat die radiochirurgische Behandlung der tumor-bedingten Trigeminusneuropathie ebenfalls ihren Stellenwert, wird jedoch auf wenige Länder beschränkt bleiben. Der Erfolg der Jannetta-OP sollte jedoch daran erinnern, dass die neurochirurgische Schmerztherapie der TGN bzw. der Trigeminusneuropathie nicht monotechnisch ist, sondern dass bei passender Indikation andere Methoden, wie z.B. die Hochfrequenzläsion nach Sweet, die Chemorhizolyse nach Håkanson, die elektrische Stimulation nach Steude sowie die chronische subarachnoidale Opiatapplikation berücksichtigt werden sollten.
Eine umfassende Literaturübersicht zur operativen Therapie der Trigeminusneuralgie finden Sie unter Literatur Nervenchirurgie












