
|
|
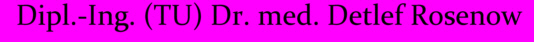
|
|
Kurzer geschichtlicher Abriss der Chirurgie degenerativer zervikaler Wirbelsäulenerkrankungen (HWS)
Einleitung
Der Zusammenhang zwischen degenerativen Erkrankungen der knöchernen Strukturen der Halswirbelsäule (sog. „zervikale Spondylose“) als Ursache für bestimmte neurologische Erkrankungen, wurde bereits im 19. Jahrhundert beschrieben (z.B. Braun 1875, zit. Grumme 2001, S. 334).
Anders als bei Erkrankungen peripherer Nerven waren operative Eingriffe an der Wirbelsäule vor allem dadurch erschwert, da der operative Zugangsweg zum Spinalkanal praktisch nur von dorsal möglich war, da hier der Weg kürzer ist als der von ventral. Vor allem bei ventralen Zugängen besteht ein erhebliches Risiko, klinisch relevante Komorbiditäten herbei zu führen. Im Bereich der Halswirbelsäule sind das vor allem die A. carotis communis, die V. iugularis interna nach rechtslateral und der Ösophagus und die Trachea nach linkslateral (bei rechtsseitigem Zugang; bei linksseitigem vice versa) und vor allem im Spinalkanal das Rückenmark selbst. So ist es nachvollziehbar, daß die ersten operativen Eingriffe an der Halswirbelsäule von dorsal über eine Laminektomie erfolgten (Horsley 1892, Krause 1907, Mixter & Barr 1934, Mixter & Ayer 1935, zit. Grumme 2001, S. 334f.) erfolgten. Bis heute wird dieser dorsale Zugang zur HWS vor allem in Japan von Orthopäden in modifizierter Form (Laminoplastik statt Laminektomie) praktiziert, wobei das Ziel der OP stets eine dorsale Entlastung des Myelons ist.
In den 1940er Jahren beschäftigten sich mehrere Arbeitsgruppen mit den Zusammenhängen zervikaler Bandscheibenvorfälle und Brachialgie: Semmes und Murphy (1943), Broager (1944), Bucy und Chenault (1944), Spurling and Scoville (1945), Elliott and Kremer (1945) sowie Eaton and Sahlgren (1946) (zit. Frykholm 1947, 1951), ohne daß man diese bis dahin operativ entfernen zu können. Frykholm, Mitarbeiter des international renommierten schwedischen Neurochirurgen Herbert Olivecrona am Serafimet Hospital, Stockholm, wandte sich ebenfalls diesem Thema zu und habilitierte sich darüber (Frykholm 1951). Er entwickelte schließlich eine OP-Technik, die bis heute nach ihm benannt wird. Gemeint ist damit ein operativer Zugang, der dem dorsalen Standardzugang zur Lendenwirbelsäule im Prinzip analog ist. Von dorsal werden dabei Teile des ipsilateralen Halbbogens sowie des segmentalen Wirbelgelenks entfernt. Danach wird das segmentale, ipsilaterale Gelbe Band entfernt und erhält so Zugang einerseits zur segementalen Zervikalwurzel sowie zum betreffenden Bandscheibenfach. Anders als im lumbalen Bereich verlassen die Zervikalwurzeln annähernd horizontal den Spinalkanal.
Ventrale Operationstechniken an der Halswirbelsäule
Der ventrale Zugang zur Halswirbelsäule wurde wohl erstmals 1864 von dem Franzosen Boudof beschrieben, der einen Zugang zur zervikalen Apophyse zur Ableitung eines Abszesses nutzte (Wiltse 1997, S. 19). In den 1930er Jahren hingegen nutzten HNO-Chirurgen diesen Zugang regelmässig um ventrale Osteophyten abzutragen, die Schluckbeschwerden verursachten (z.B. bei M. Forestier-Ott). Ebenfalls nutzten Tumorchirurgen diesen Zugang zur Entfernung von befallenen Lymphbahnen in den vorderen Anteilen der Halswirbelsäule (Wiltse 1997, S. 19).
Die Wortbeiträge sowie die anschließende Diskussion eines Symposiums über Verletzungen der Halswirbelsäule anläßlich des "Fourth Congress of Neurological Surgeons" 1954 in New York City zeigt sehr gut den Stand der Technik Anfang der 1950er Jahre bei der Versorgung von Halswirbelsäulenverletzten:
• Traktion (Extension) mit der Crutchfied- oder Blackburnzange
• Rein dorsale Entlastung (Laminektomie)
• Dorsale Entlastung sowie Einbringen eines Knochenspans zwischen die nach oben und unten angrenzenden Wirbelbögen (Greffe d´Albee)
• Laminektomie plus Abtragen von Retrospondylosen von weit lateral mittels Meißel ( in rein makrochirurgischer Technik)
Alle oben genannten Techniken waren einerseits von den Ergebnissen her unbefriedigend bzw. bargen ein zu hohes Risiko der Verletzung des Myelons in sich (Dereymaeker 1956). Dereymaeker und auch wohl andere Autoren (s.u.) nahmen die genannten Technikimmanenten Nachteile als Grund zur Entwicklung des ventralen Zugangs.
1952 hatte der Orthopäde Robert Bailey erste ventrale, zervikale Stabilisierungs-OPs an der Universitätsklinik von Michigan in Arbor bei Patienten mit Luxationsfrakturen der HWS durchgeführt. Die Idee stammte offenbar von Leroy C. Abott, früher selbst in Ann Arbor, University of Michigan, tätig. Er war zu dieser Zeit (1952) aber bereits Direktor der Orthopädischen Universitätsklinik in San Francisco (Bailey RW, Badgley CE, 1960).
Der Leiter der Abteilung für Neurochirurgie an der Universitätsklinik in Louvain (Löwen), Albert Dereymaeker, berichtete auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Neurochirurgie der französischen Sprache vom 29. und 30. November 1955 in Paris über 5 Patienten, die er wegen er ihrer Bandscheibenvorfälle von ventral operiert und mittels Knochenspan fusioniert hatte (Dereymaeker & Muller, 1956). George Perret, 1958 Mitarbeiter bei Loyal Davis am Northwestern Hospital, Chicago, berichtete über Dereymaeker, der anläßlich einer Fortbildungsreise in die USA an verschiedene neurochirurgischen Einrichtungen 1954 bereits über 34 Patienten berichtete, die er von ventral an der HWS operiert hatte. Dereymaeker hatte diese OP-Technik an den Kliniken, an denen er in den USA hospitierte demonstriert - sie entsprach exakt der von Smith 1953 erstmals vorgenommenen Operation (Perret, s. Cloward 1958, S. 616, Dereymaeker & Muller 1958). Anzumerken ist, daß derartige Operationen in Lokalanästhesie mit 0,5%iger Xylocainlösung durchgeführt wurden (Cloward 1962, S. 112).
Bereits seit 1953 hatten der Neurochirurg George W. Smith und der Orthopäde Robert A. Robinson (1955) die ventrale OP-Technik am Johns Hopkins Hospital in Baltimore angewendet (Diskussionsbeitrag Walker, s. Cloward 1958, S. 616) und über ihre OP-Technik im Rahmen eines Vortrages am 22. April 1958 anläßlich des Jahrestreffens der Harvey Cushing Society in Washington, D.C., berichtet (Wilkins & Wilkins 2000, S. 491). Smith & Robinson wählten dabei einen longitudinalen Zugang zur HWS am medialen Rand des M. sternocleidomastoideus, wohingegen Cloward einen transversalen Zugang im Bereich einer vorgegebenen Hautfalte wählte, wohl aus kosmetischen Gründen.
Cloward berichtete später, daß er durch ein zervikales Diskogramm, welches ihm Dr. Exum Walker 1956 in Atlanta, Georgia, vorlegte, überhaupt erst auf die Machbarkeit eines ventralen Zugangs zur HWS aufmerksam wurde. Bis dato seien ihm die Publikationen von Smith & Robinson (1955 bzw. 1958) bzw. Dereymaeker & Muller (1956, 1958) nicht bekannt gewesen (Wilkins & Wilkins 2000, S. 491).
Sehr lesenswert zur Technik des ventralen Zugangs ist die Diskussion, die im Anschluß des Vortrags von Ralph Cloward über seine OP-Technik auf der 26. Jahrestagung der Harvey Cushing Society in Washington D.C. am 22. April 1958 stattfand (Cloward 1958, 614-617). Der konventionelle Standardzugang bestand zu dieser Zeit aus einem dorsalen Zugang über eine Laminektomie (s.o.). Cloward hatte über seine Serie von 47 mit seiner OP-Technik operierter Patienten berichtet und die Vorteile des ventralen Zugangs zur damaligen Zeit klar herausgestellt: Technisch einfacher, weniger schmerzhaft für den Patienten sowie kürzere Krankenhausaufenthalte. Der Diskussionsleiter John Raaf, der stellvertretend für Glen Spurling eingesprungen war, war mit dem Thema überfordert war und die Diskussionsleitung an William Scoville abgab, sah keine Notwendigkeit für diesen Zugang, weil er aus seiner Sicht nur selten anzuwenden war. A. Earl Walker, Direktor der neurochirurgischen Klinik am Johns Hopkins-Hospital unterstützte den Zugang nach Smith-Robinson und Cloward und stellte fest, daß der Zugang logisch sei und nach George Smiths Weggang aus der Klinik (1956 als Abteilungsleiter nach Augusta, GA (Anm. des Verfassers)) fortgeführt wurde. Cloward stellte zusammenfassend fest "you can´t teach an old dog new tricks".
Es ist also davon auszugehen, daß diese OP-Technik zeitgleich sowohl in Europa als auch in den USA entwickelt wurde.
Der ventrale Zugang ist heute in der Wirbelsäulenchirurgie ein Standardzugang geworden und die Technik von Dereymaeker & Muller sowie Smith & Robinson eine Standard-OP-Technik, wohingegen die eigentliche OP-Technik nach Cloward heute keine Relevanz mehr besitzt, der transversale Zugang aber schon.

Bereits seit 1953 hatten der Neurochirurg George W. Smith und der Orthopäde Robert A. Robinson (1955) die ventrale OP-Technik am Johns Hopkins Hospital in Baltimore angewendet (Diskussionsbeitrag Walker, s. Cloward 1958, S. 616) und über ihre OP-Technik im Rahmen eines Vortrages am 22. April 1958 anläßlich des Jahrestreffens der Harvey Cushing Society in Washington, D.C., berichtet (Wilkins & Wilkins 2000, S. 491). Smith & Robinson wählten dabei einen longitudinalen Zugang zur HWS am medialen Rand des M. sternocleidomastoideus, wohingegen Cloward einen transversalen Zugang im Bereich einer vorgegebenen Hautfalte wählte, wohl aus kosmetischen Gründen.
Cloward berichtete später, daß er durch ein zervikales Diskogramm, welches ihm Dr. Exum Walker 1956 in Atlanta, Georgia, vorlegte, überhaupt erst auf die Machbarkeit eines ventralen Zugangs zur HWS aufmerksam wurde. Bis dato seien ihm die Publikationen von Smith & Robinson (1955 bzw. 1958) bzw. Dereymaeker & Muller (1956, 1958) nicht bekannt gewesen (Wilkins & Wilkins 2000, S. 491).
Sehr lesenswert zur Technik des ventralen Zugangs ist die Diskussion, die im Anschluß des Vortrags von Ralph Cloward über seine OP-Technik auf der 26. Jahrestagung der Harvey Cushing Society in Washington D.C. am 22. April 1958 stattfand (Cloward 1958, 614-617). Der konventionelle Standardzugang bestand zu dieser Zeit aus einem dorsalen Zugang über eine Laminektomie (s.o.). Cloward hatte über seine Serie von 47 mit seiner OP-Technik operierter Patienten berichtet und die Vorteile des ventralen Zugangs zur damaligen Zeit klar herausgestellt: Technisch einfacher, weniger schmerzhaft für den Patienten sowie kürzere Krankenhausaufenthalte. Der Diskussionsleiter John Raaf, der stellvertretend für Glen Spurling eingesprungen war, war mit dem Thema überfordert war und die Diskussionsleitung an William Scoville abgab, sah keine Notwendigkeit für diesen Zugang, weil er aus seiner Sicht nur selten anzuwenden war. A. Earl Walker, Direktor der neurochirurgischen Klinik am Johns Hopkins-Hospital unterstützte den Zugang nach Smith-Robinson und Cloward und stellte fest, daß der Zugang logisch sei und nach George Smiths Weggang aus der Klinik (1956 als Abteilungsleiter nach Augusta, GA (Anm. des Verfassers)) fortgeführt wurde. Cloward stellte zusammenfassend fest "you can´t teach an old dog new tricks".
Es ist also davon auszugehen, daß diese OP-Technik zeitgleich sowohl in Europa als auch in den USA entwickelt wurde.
Der ventrale Zugang ist heute in der Wirbelsäulenchirurgie ein Standardzugang geworden und die Technik von Dereymaeker & Muller sowie Smith & Robinson eine Standard-OP-Technik, wohingegen die eigentliche OP-Technik nach Cloward heute keine Relevanz mehr besitzt, der transversale Zugang aber schon.

Dorsale Operationstechniken an der Halswirbelsäule
In den 1940er Jahre beschäftigten sich mehrere Arbeitsgruppen mit den Zusammenhängen zervikaler Bandscheibenvorfälle und Brachialgie:
Semmes und Murphy (1943), Broager (1944), Bucy und Chenault (1944), Spurling and Scoville (1945), Elliott and Kremer (1945) sowie Eaton and Sahlgren (1946) (zit. Frykholm 1947, 1951), ohne daß man diese bis dahin operativ beheben zu können.
Frykholm, Mitarbeiter des schwedischen Neurochirurgen Herbert Olivecrona, wandte sich ebenfalls diesem Thema zu, habilitierte sich schließlich darüber (Frykholm 1951) und entwickelte eine OP-Technik, die bis heute nach Frykholm benannt wird.
Gemeint ist damit ein operativer Zugang, der dem dorsalen Standardzugang zur Lendenwirbelsäule im Prinzip analog ist. Von dorsal werden dabei Teile des ipsilateralen Halbbogens sowie des segmentalen Wirbelgelenks entfernt. Danach wird das segmentale, ipsilaterale Gelbe Band entfernt und erhält so Zugang einerseits zur segementalen Zervikalwurzel sowie zum betreffenden Bandscheibenfach. Anders als im lumbalen Bereich verlassen die Zervikalwurzeln annähernd horizontal den Spinalkanal durch die Neuroforamina (Nervenwurzellöcher), so daß die Wurzelabgänge vom Duralschlauch gut eingesehen werden können und die Wurzelverläufe nach lateral in die Neuroforamina mit geeigneten Instrumenten gut ausgetastet werden können. Dennoch ist dieser Zugang nur bei sehr lateral gelegenen "weichen" Bandscheibenvorfällen geeignet. Auch raumfordernde Synovialzysten aus den Wirbelgelenken können über diesen dorsalen Zugang sehr gut angegangen werden. Ventral gelegene Pathologien wie knöcherne Strukturen (Retrospondylosen oder knöcherne Foraminalstenosen) können über diesen Zugang nicht sicher angegangen werden. Hier wird eine bessere Dekompression neuraler Strukturen über einen ventralen Zugang erzielt.
Ventrale Fusion
Hierbei wird das betroffene Bandscheibenfach zunächst mittels eines geeigneten Sperrers (meist Caspar©- oder Cloward©-Spreizer) auseinandergezogen von vorne fast vollständig ausgeräumt, das Restbandscheibengewebe von Grund- und Deckplatte mittels scharfem Löffel oder anderer Instrumente (z.B. Fräse) abgeschabt, das hintere Längsband durchtrennt, beide Neuroforamina erweitert und dann das Fusionsmaterial eingebracht. Manche Chirurgen belassen das hintere Längsband mit dem Argument, daß so keine raumfordernden epiduralen Hämatome mit Querschnittsfolge entstehen können (stimmt!), andere mit dem Argument, daß das hintere Längsband eine Stabilitätsfunktion besitzt. Wird das hintere Längsband nicht abgetragen, können die Neuroforamina nicht adäquat dekomprimiert werden. Daher sollte das hintere Längsband aus anatomischen Gründen stets entfernt werden.
Klinische Ergebnisse
Vergleich monosegmentale ventrale Fusion und hintere zervikale Foraminotomie
Wie oben dargestellt, existieren heute im Wesentlichen nur mehr zwei OP-Techniken an der Halswirbelsäule zur Entfernung von Bandscheibenvorfällen: Entweder der ventrale Zugang mit Entfernung einer Bandscheibe und anschliessender Fusion mittels einem Platzhalter (cage) bzw. mit und ohne zusätzlicher Plattenspondylodese (Smith-Robinson-Technik), oder der hintere Zugang (die sog. Frykholm-Technik), bei der nur eine Foraminotomie, also eine Nervenwurzellochfreilegung , vorgenommen wird. Die sog. Cloward-OP-Technik spielt heute in der Wirbelsäulenchirurgie aus verschiedenen Gründen keine Rolle mehr, welches nicht bedeutet, dass diese OP-Technik nicht mehr angewendet wird.
Wie sind nun die Ergebnisse dieser beiden genannten OP-Techniken? Im Rahmen einer monozentrischen Untersuchung, wurden nun die klinischen Vergleichsergebnisse an insgesamt 201 Patienten im Zeitraum 2008-2013 über einen Zeitraum von etwa 24 Monaten nach der OP untersucht (Selvanathan 2015). 150 Patienten wurden ventral fusioniert, bei 51 Patienten wurde eine OP nach Frykholm vorgenommen. Die Ergebnisse zeigen keine statistisch signifikanten Unterschiede auf dem 5%-Niveau über den Beobachtungszeitraum von ca. zwei Jahren. Leichte Tendenzen zu besseren postoperativen Ergebnissen können auch dadurch aufgetreten sein, dass das Patientenkollektiv, welches nur foraminotoimiert wurde deutich geringer als das andere war, deren Trennschärfe mithin grösser ist, so dass zumindest nicht ausgeschlossen werden kann, dass letztlich die Ergebnisse identisch sind. s zeigt sich ferner, dass die "Frykholm-OP" insgesamt deutlich seltener angewendet wird als die nach "Smith-Robinson", welches auch der eigenen Erfahrung entspricht. Das Risiko einer Anschlussinstabilität mit entsprechender operativer Sanierung ist jedenfalls sehr gering, und auch das Risiko eines Rezidivbandscheibenvorfalls bei der Frykholm-Technik ist extrem gering.
Salvanathan et al. haben ebenfalls fünf weitere Studien mit analoger Fragestellung kritisch beleuchtet und die Schwächen herausgearbeitet (Salvanathan 2015, S. 1598). Lediglich die Arbeit von Korinth et al. , in der retrospektiv 124 Patienten mit ventraler Fusion mit 168 Patienten verglichen wurden, die mittels Frykholm-Technik operiert wurden, zeigten für beide Gruppen eine hohe Patientenzufriedenheit: Trotz der von Salvanathan angebrachten berechtigten Kritik am Studiendesign der fünf Studien, konnte aber insgesamt die Arbeit von Korinth zeigen, dass "gute" bis "sehr gute" Ergebnisse bei der ventralen Fusionsgruppe in 93,6% und in 85,1% zeigte. Dieses Ergebnis ist auf dem 5%-Niveau statistisch signifikant. Lediglich die Komplikationsrate war in der Fusionsgruppe mit 6.5% höher als in der Frykholm-Gruppe (1.8%) (p<0,05).
Autologes Knochenmaterial
Die älteste ventrale Fusionstechnik ist das Einbringen von autologem, also körpereigenem Knochenmaterial, um so eine knöcherne Fusion der Wirbelsäule herbeizuführen (Albee 1911). Da es körpereigenes Gewebe ist, besteht generell kein Risiko einer Abstoßungsreaktion. Zu beachten ist, daß die kompressive Festigkeit eingebrachter Knochensubstanz unterschiedlich ist: Spongiöse Knochenspäne haben nur 60% Kompressionsfestigkeit im Vergleich zu trikortikalen (Brantigan 1993). Es kann aber zu einer Sinterung des eingebrachten Knochenspans führen bzw. zu einer Osteonekrose kommen, bei der auf Grund fehlender Durchblutung des Knochenspans die Knochensubstanz abgebaut wird. Dies hat fast immer eine Revisionsoperation zur Folge, da das betroffene Segment instabil wird, was sich fast immer durch anhaltende, segmentale Nackenschmerzen bemerkbar macht.
Knochenzement (Polymethylmethacrylat (PMMA))
Hierbei handelt es sich um Knochenzement, wie er üblicherweise in der Orthopädie/Traumatologie zur Befestigung von Endoprothesen verwendet wird. Bekannte Handelsnamen sind oder waren Palacos© oder Sulfix©. Sulfix© hatte dabei den Vorteil, daß es flüssig war, so daß es eingegossen werden konnte. So wurde das Risiko einer Lunker-Bildung reduziert. Älteres Palacos© hingegen mußte gestopft werden, so daß eben ein hohes Risiko einer Lunkerbildung bestand. Heute gibt es Palacos© mit verschiedenen Flüssigkeits- oder Viskositätsstufen, so daß dieser Nachteil heute nicht mehr existiert. Diese OP-Technik wurde in Deutschland in 1960er Jahren durch Wilhelm Grote an der Neurochirurgischen Universitätsklinik Bonn eingeführt (Grote et al. 1970). Hierbei ist insbesondere darauf zu achten, daß der eingebrachte Knochenzement nicht zu voluminös und der daraus entstehende Dübel nicht zu groß war, um eine knöcherne Umbauung zu gestatten. PMMA kann nicht knöchern durchbaut werden, da in ihn kein körpereigenes Gewebe einwachsen kann. Bei korrekter OP-Technik kleidet man das Bandscheibenfach sowohl seitlich als auch zum Spinalkanal hin mit blutstillendem, resorbierbarem Material aus (z.B. Gelitta©) und gießt dann das PMMA ein. Benötigt werden dabei zwischen 1-1,5 ml Volumen. Bei Einbringen eines PMMA-Dübels muß zusätzlich in Grund- und Deckplatte ein sog. „Ankerloch“ eingefräst werden, um eine Verrutschen des Dübels nach vorne oder hinten (hier mit dem Risiko eines Querschnittes) zu verhindern. Die bei der Aushärtung entstehenden Temperaturen liegen bei ca. 70°C, so daß das auf die Dura aufgelegte Schwämmchen auch eine isolierende Funktion hat.
Die bei dieser Technik fehlende Möglichkeit der Durchbauung bedeutet, daß ein erhöhtes Risiko einer fehlenden knöchernen Fixierung oder Fusion des Segmentes besteht. Biomechanisch besteht dann eine sog. „Pseudarthrose“, weil durch die fehlende knöcherne Fusion der Körper versucht, die pathologische Mobilität durch Knochenanbau nach vorne (Ventrospondylose) und hinten (Retrospondylose) in Richtung des Spinalkanals auszugleichen. Vor allem durch die dorsalen Knochenanbauten in den Spinalkanal hinein kann das Rückenmark beeinträchtigt werden, und es kann zu einer sog. „Myelopathie“ kommen, was zu einer chronischen Schädigung des Rückenmarkes führt. Derartige Zustände bedürfen stets einer Revisions-Operation, wobei die Knochenanbauten entfernt werden müssen und dann das betroffene Segment mittels Platzhalter („Cage“) und Schrauben fixiert wird, um eine Fusion herbeizuführen, die nach üblicherweise 12 Wochen erzielt ist.
Andere alloplastische Werkstoffe
Um die potentiellen Nachteile der oben genannten Fusionstechniken zu vermeiden, wurden in den 1990er Jahren als Platzhalter sog. „Cages“, also Käfige entwickelt, die verschieden große Öffnungen aufweisen, um zunächst bindegewebig, und dann knöchern durchbaut zu werden. Die ersten derartigen Implantate bestanden aus einem thermoplastischen Kunststoff aus der Reihe der Polyaryletherketone, dessen bekanntester Vertreter das Polyarylätherätherketon, kurz: PEEK, ist. Ein großer Vorteil ist die Röntgendurchlässigkeit, die es gestattet, in der MRT auch segmentale Strukturen ohne relevante Signalstörungen (Artefakte) zu beurteilen. Die als Alternative verwendeten Metallkörper bestehen aus Titanlegierungen mit nur geringem Nickelanteil, mit nur einem geringen allergischen Risiko bei Patienten z.B. mit Nickelallergie. Ein Nachteil dieser metallischen Cages ist die ausgeprägte Signalstörung im Bereich der Implantationsstelle, also z. B. in einem Bandscheibenfach, die die bildmorphologische Interpretation derartiger Abschnitte erschwert.
Fusion ohne Fusionsmaterialien
Bei dieser OP-Technik wird nur die Bandscheibe entfernt, ohne daß ein Platzhalter eingebacht wird. Diese OP-Technik wurde in Deutschland vor allem an der Neurochirurgischen Uniklinik Freiburg i. Br. (Prof. Dr. W. Seeger) angewendet. Diese Technik war durchaus erfolgreich, wie Spätergebnisse zeigen. In der Röntgenkontrolle wird in der seitlichen Projektion ein Bild gezeigt, das an ein Teil-Klippel-Feil erinnert (Spontanfusion zweier Halswirbelkörper). Diese Technik wird heute nicht mehr verwendet, da nach eigener Erfahrung vor allem die ersten postoperativen Wochen durch heftige Nackenschmerzen geprägt sein können, aber nicht müssen. Diese OP-Technik besitzt heute keine Relevanz mehr (Bertalanffy & Eggert 1988a, Bertalanffy, Eggert & Gilsbach 1988b, Bertalanffy & Eggert 1989, Hadley & Sonntag 1998). Vor allem ist diese OP-Technik aus abrechnungstechnischen Gründen uninteressant, da sie nach DRG vollkommen unattraktiv geworden ist (sie stellt keine unmittelbare biomechnische Fusion dar, sondern eine erheblich verzögerte Spontanfusion), so dass der Eingriff nur mehr mit erhebklichen Abschlägen abgerechnet werden kann.
Ventrale Verplattung
Insbesondere die Arbeitsgruppe um Caspar an der Neurochirurgischen Uniklinik in Homburg/Saar hat stets das Einbringen eines Platzhalters und eine zusätzliche ventrale Verplattung propagiert ohne daß sich die Langzeitergebnisse im Vergleich zur alleinigen interkorporellen Fusion ohne Verplattung unterschieden. Lediglich bei Vorliegen einer segmentalen Instabilität muß eine zusätzliche Sicherung des Interponats durch ein verschraubtes System herbeigeführt werden, wobei heute moderne „Cages“ zur Verfügung stehen, die selbst in die angrenzenden Wirbelkörper eingeschraubt werden.
Ergebnisse: Die Ergebnisse aller gewählten Fusionstechniken sind nach einem halben Jahr als gleichwertig anzusehen. Auch bei fehlendem Einbringen eines Platzhalters ist das Segment fusioniert und auch aufgerichtet.
Zervikale Bandscheibenprothesen
Ein Nachteil der ventralen (vorderen) Versteifung (Spondylodese, Fusion) ist die Aufhebung der vorderen Beweglichkeit zweier oder mehrerer aneinander grenzender Wirbelkörper, obschon dieser Umstand klinisch praktisch nicht darstellbar ist bzw. von den Patienten nicht bemerkt wird. Dennoch erschien es logisch, nach einer Möglichkeit zu suchen, die vordere Beweglichkeit durch eine sog. "Bandscheibenprothese" zu erhalten. Die erste auf dem Markt erhältliche Prothese war das sog. Frenchay-Modell, benannt nach der Krankenanstalt, an der dieses Implantat entwickelt wurde (Cummins 1998). Die abgebildeten Röntgen-Bilder erscheinen bzgl. der Indikationsstellung aus heutiger Sicht abenteuerlich (u.a. heterotope Ossifikationen, kyphotische Fehlhaltung der HWS). Insgesamt wurden ca. 300 Stück dieses Implantats verbaut. Es setzte sich in der klinischen Praxis nicht durch (Firsching 2005).
Eine Weiterentwicklung stellte dann die seit 2001 erhältliche und nach seinem Entwickler Bryan genannte Bandscheibenprothese dar (Bryan 2002, zit. Firsching 2005), die bis heute am Markt erhältlich ist. Es lag nahe, daß von anderen Firmen weitere Modelle bis heute entwickelt und weiterentwickelt wurden, wobei auf Details hier nicht eingegangen werden soll.
Dennoch läßt es die derzeit existierende Datenbasis nicht zu, dem totalen zervikalen Bandscheibenersatz das Merkmal "Standard-OP-Technik" zuzuordnen. Eine Langzeitüberlegenheit gegenüber der Fusion kann derzeit nicht belegt werden. Diese OP-Methode stellt lediglich eine operative Alternative an der Halswirbelsäule dar, wobei vor allem jüngere Menschen bis ca. 30 Lebensjahre als Patientenzielgruppe in Frage kommen. Nikotinkonsum, gesicherte Osteopenie sowie Instabilität sind Kontraindikatonen.
Bestätigt wird diese Haltung durch eine kürzlich erschienen Arbeit, in der ein Cochrane Review bzgl. der Fragestellung "Bandscheibenprothese im Vergleich zur Fusion bei monosegmentaler, zervikaler Bandscheibenerkrankung" vorgenommen wurde (Boselie et al. 2013). Im Ergebnis zeigen sich zwar geringe bis mäßige bessere Ergebnisse bei Patienten mit Bandscheibenprothesen, die Differenzen waren jedoch sehr gering und wurden als klinisch irrelevant erachtet (Evidenzlevel I). Auch dieses Ergebnis rechtfertigt den nicht-routinemäßigen Einsatz von Bandscheibenprothesen bei Patienten mit zervikalen Bandscheibenerkrankungen.
Zudem konnte in einem Patientengruppenvergleich (ein- oder zweisegmentale Versorgung mittels zervikaler Bandscheibenprothese vs. ein- oder zweisegmentaler Fusion) zwischen 2002-2009 (Nandyala 2014) gezeigt werden, dass es zwischen den Behandlungsgruppen keinen Unterschied zwischen den Patientencharakteriska, den frühen postoperativen Ergenissen und den Kosten in den jeweiligen Behandlungsgruppen gab. Mithin liegt auch kein sachlicher Grund vor, bandscheibenprothesen routinemäßig einzusetzen.
Eine aktuelle Übersichtsarbeit (Sundberg 2014) bestätigt letztlich das oben Genannte:
- Die Implantation zervikaler Bandscheibenprothesen hat sich als Alternative zur ventralen
Fusion nach neuraler Dekompression von Patioenten entwickelt, bei denen eine konservative
Therapie versagt hat.
- Die bisher vorliegenden klinischen Untersuchungen zeigen keinen statistisch signifikanten Unterschied
zwischen den beiden Behandlungsmethoden über einen Zeitraum von 4-5 Jahren.
- Weitere klinische Studien sind nötig um auch die zumindest Gleichwertigkeit der beiden Behandlungsmethoden
über einen Beobachtungszeitraum über 4-6 Jahre hinaus zu belegen.
Adjacent level disease (ALD) (Anschlußinstabilität) in der HWS
s. ausführlichen Text zu diesem Thema unter dem Kapitel "Lendenwirbelsäule". Wie oben beschrieben, erfolgen in der HWS bei degenerativen Erkrankungen überwiegend ventrale, in der LWS hingegen dorsolaterale (nur Pedikelschrauben) oder ventroposterolaterale Fusionen (Spondylodesen) mit Cage und Pedikelschrauben.
Biomechanisch resultiert daraus bereits ein erheblicher Unterschied, da nur vordere Versteifungen die Beweglichkeit der segmentalen Wirbelgelenke bzw. die der angrenzenden Wirbelgelenke logischerweise deutlich weniger als bei der hinteren Versteifung einschränkt, da diese die segmentale Wirbelgelenkbeweglichkeit vollständig aufhebt und die der angrenzenden Wirbelgelenke logischerweise entsprechend erhöht. Diese biomechanischen Erwägungen könnten eine Erklärung dafür sein, daß die Inzidenz der ALD in der HWS deutlich unter der der LWS liegt.
In einem Übersichtsartikel wurden für die HWS ein (bildmorphologisches) Auftreten zwischen 9 und 17% gefunden, wobei die jährliche Inzidenz der Anschlußinstabilität lediglich zwischen 1,5 und 4% liegt (Hillibrand 2004, zit. Kallisvaart 2010). Andere Autoren fanden ein Jahr nach monosegmentaler zervikaler Spondylodese eine normale Beweglichkeit der Anschlußsegmente (Grochulla 2009, S. 400). Neuere Publikationen halten die Anschlußinstabilität für einen physiologischen Zustand, der durch eine Fusion nur beschleunigt wird. Auch wird mangels entsprechender qualitativ guter Datenlage die Frage gestellt, ob eine zervikale Bandscheibenprothese mit den (hier) an anderer Stelle beschriebenen theoretischen Vorteilen diese begrenzt oder gar aufhebt (Ponnapan 2008). Letztlich bestätigt diese Arbeit den experimentellen Charakter von Bandscheibenprothesen. In einer großen Serie von 900 Patienten, die sich an der HWS Revisionseingriffen im Zeitraum 1994-2000 unterzogen, wurden Zahlen zwischen 1 bis 1,5 % gefunden, wobei monokorpektomierte Patienten mit ausschließlich ventraler instrumentierter Spondylodese ("vordere Verschraubung") einen vergleichsweise hohen Prozentzahl von 5,6% aufwiesen, ohne daß dafür eine Erklärung gefunden worden wäre. Interessanterweise waren Patienten mit einer Multikorpektomie (über 2 entfernte und ersetzte Wirbelkörper) und rein dorsaler Spondylodese ("hintere Verschraubung") mit nur 1,5 % in dem Patientenkollektiv vertreten (Greiner-Perth 2009).
Im Rahmen einer prospektiven, randomisierten Studie wurde über einen postoperativen Untersuchungszeitraum von 2-4 Jahren zwei Patientenkollektive untersucht: Eine Gruppe mit klassischer ventraler Fusion über 1 bis zwei Segmente (n=57) mit einer Gruppe mit prothetischem Bandscheibenersatz (n=113) (Nunley, 2012). Ziel der Untersuchung waren dabei die Faktoren, die das Auftreten des Adjacent Level Disease (ALD) ("Anschlußinstabilität") beeinflussen. Das Ergebnis zeigte über einen mittleren Nachbeobachtungszeitraum von 38 Monaten, daß 14,3% der fusionierten (n=9) und 16,8% (n=19) der prothetisch versorgten Patienten eine Anschlußinstabilität entwickelten. Hauptrisikofaktoren waren dabei Osteopenie (Knochenmangel) und lumbale degenerative Bandscheibenerkrankung.
Das Ergebnis der Studie ist bedenklich, da es zeigt, daß die Indikationsstellung für das Einbringen einer Bandscheibenprothese sehr großzügig gewesen sein muß. So betrug das Alter der Patientengruppe mit Bandscheibenprothese zwischen 45 Jahre (+/- 5,02 Jahre) und der Anteil der Raucher in dieser Gruppe lag bei 38,1%.
Das Einbringen zervikaler Bandscheibenprothesen bleibt daher unverändert experimentelle Wirbelsäulenchirurgie und sollte maximal bis Ende der dritten Lebensdekade und nur bei Nichtrauchern erfolgen. Auch andere Riskofaktoren wie häufiger Genuß von Phosphat-haltigen Getränken (Cola-Getränke) (Phosphat ist ein Calcium-Antagonist) sollten bei der Indikationsstellung beachtet werden.

Differentialdiagnosen
Da die sensible Ataxie, vor allem bei älteren Menschen, eine der führenden Symptome bei einer hochgradigen zervikalen Spinalkanalstenose mit Myelopathie ist, sollten andere Diagnosen ausgeschlossen werden: Normalhydrozephalus, Amyotrophe Lateralsklerose (Kügelgen 1983).
Risiken/Komplikationen
Verletzung großer Gefäße: In Frage kommen hierbei vor allem Verletzungen der Halsschlagader (A. carotis communis) und der V. jugularis interna, wenn der Zugangsweg zu weit nach lateral angelegt wird oder intraoperativ zu weit nach lateral präpariert wird. Trotz großer Vorsicht kann es (selten) bei adäquater Dekompression von Nervenwurzeln oder der Rezessus laterales zu Verletzungen der A. vertebralis (Wirbelsäulenarterie) oder von Seitenästen kommen. Das Risiko derartiger Verletzungen kann mit 0,5% angenommen werden (eigene Serie). Verletzungen von Seitenästen bleiben folgenlos, bei größeren Verletzungen der A. vertebralis bleiben ca. 50% der Patienten asymptomatisch.
Verletzung nervaler Strukturen: Das Risiko einer Rückenmarksverletzung ist als gering anzusehen (0,3%, Arnold, Meredith & McMahon 2004, S. 35; eigene Serie: 0%). Vollständige Verletzungen von Zervikalwurzeln kommen ebenfalls selten vor (0,1-1,8%, Arnold, Meredith & McMahon 2004, S. 35, eigene Serie n=1)). Verletzungen von Nervenwurzeltaschen kommen ebenfalls selten vor und bleiben i.d.R. folgenlos (eigene Serie: n=2). Insgesamt wird das Risiko vorübergehender oder bleibender Schäden nervaler Strukturen mit 2,3-3,3% angegeben (Grumme 1993, S. 135). Unfähigkeit, in hohen Tonlagen zu singen (Druckläsion des N. laryngeus superior) (n=3 Grumme 1994, S. 136)); eigene Serie: n=2), Heiserkeit (Druckläsion des N. recurrens) mit 0,7-0,8% (löst sich nach Wochen bis Monaten auf) (Grumme 1994, S. 135; eigene Serie: ca. 1%) , Teilhornersyndrom durch Druckläsion des zervikalen Sympathicus (0,3-1% (Grumme 1994, S. 135; eigene Serie: 0,5%). Hirnnervenläsionen werden vor allem bei "hohen" zervikalen Eingriffen (oberhalb HW 3) beschrieben: N. hypoglossus (0,05-0,4% (Grumme 1994, S. 136; eigene Serie 0%), N. vagoglossopharyngeus und N. fazialis (17,5%), N. accessorius n=1 (Grumme 1994, S. 136). Sämtliche peripheren Hirnnervenläsionen waren temporär und lösten sich nach Monaten auf.
Sonderfall: Reversible Läsion der C5- und (seltener) C6-Wurzel: Ohne daß es intraoperativ zu sichtbaren Verletzungen dieser Wurzeln käme, kann es (selten) postoperativ zur Unfähigkeit kommen, den oder die Arme seitlich zu heben (Deltoideusfunktion = C5-Innervation) bzw. den Arm zu beugen (Biceps-brachii-Funktion = C6-Innervation). Alternativ kann zu starken Schmerzen im Ausbreitungsgebiet der C5-Wurzel kommen. Derartige Schmerzen bzw. Wurzelläsionen erholen sich innerhalb von Wochen bis (selten) Monaten spontan in 70% vollständig (Currier 2012), stellen aber für die betroffenen Patienten vorübergehend eine starke Behinderung dar. Es existiert keine spezifische Behandlungsform, die die Erholung beschleunigen würde (Currier 2012). Eine genaue Ursache ist nicht bekannt. Diskutiert wird am ehesten (unvermeidbarer) Zug an der Wurzel, die dadurch entsteht, wenn es im Rahmen der adäquaten Dekompression der Wurzel zu einer segmentalen Revaskularisierung auf Rückenmarksebene kommt, welches erklärt, daß sich diese klinischen Symptome stets erholen. Die Inzidenz wird mit 5,6 bei "einfacher" spondylotischer Myelopathie bzw. 8,3% beim Sonderfall des OPLL (Verknöcherung des hinteren Längsbandes) angegeben (Rhin et al. 2008), bzw. 1,6% bei ventralem Zugang und 8,6 bei dorsalem Zugang in einer Serie von insgesamt n=1001 (Bydon 2014). In der eigenen Serie von ca. n= 950 beträgt die Inzidenz 1,5% bei ventralem Zugang mit stets vollständiger Erholung nach Wochen bis Monaten. Currier fand in seinem systematischen Review eine hohe Evidenzrate, daß multimodales intraoperatives Monitoring eine Störung anzeigt (z.B. eine C5-Läsion), ohne daß jedoch hierdurch ein Auftreten verhindert werden könnte. Verkürzt formuliert zeigt einem das intraoperative Monitoring an, daß mit einer motorischen Störung postoperativ zu rechnen ist, ohne daß sich daraus intraoperativ sinnvolle Konsequenzen ergäben. Demzufolge ist also die Elektrophysiologie hier als reiner Selbstzweck anzusehen.In einer sehr gross angelegten Kohortenstudie wurden folgende erhöhte Risiken gefunden: Zunehmende Anzahl von Korpektomien (grösser 1), wobei mit höherem Lebensalter der höchste Prädiktor einer postoperativen gefunden wurde. Bei posteriorem Zugang (Frykholm-Zugang) wurden die höchsten Zahlen bei Dekompressionen der C4 und C5-Wurzel gefunden. Eigene Zahlen können diese Zahlen (Bydon 2014) bei Korpektomien > als 1 nicht bestätigen. Die eigenen Ergebnisse zeigen stets, dass ausgeprägte Kompressionen der C5- und C6-Wurzeln über längere Zeiträume den höchsten Prädiktor darstellen, ungeachtet der Anzahl der Korpektomien. Auch das Alter stellt bei den eigenen Zahlen kein erhöhtes Risiko dar.
Wirbelkörperendplatteneinbruch: Insbesondere bei Frauen ab dem 50. Lebensjahr ist die Knochensubstanz osteopenisch verändert, d.h., daß die Knochensubstanz im Wirbelkörper selbst, also in der Spongiosa, an Tragkraft verloren hat. Die Auswertung der eigenen Serie hat gezeigt, daß die Verwendung von Titancages ein höheres Risiko tragen (eigene Serie: 5% (nur bei mono- oder bisegmentalem Bandscheibenersatz)), dass sich Wirbelkörperendplatteneinbrüche (meist Deckplatte) entwickeln als das bei Verwendung von Cages aus PEEK (Polyätherätherketon) der Fall ist (eigene Serie: 0%). Als Grund kann angenommen werden, daß der Elastizitätsmodul von PEEK und kortikaler Knochensubstanz (Kompacta) ungefähr gleich ist (17 GPa) (Chang-Yung 2008). Daher wird auf die Verwendung von Titancages vollständig verzichtet.
Polymethylmethacrylat (PMMA): Sowohl bei eigenen (n=8/40) als auch bei auswärtig operierten Patienten (n=4) fiel auf, daß Patienten, die mono- oder multisegmental mit PMMA versorgt wurden, über persistierende Nackenschmerzen klagten, die sich bei genauer chirodiagnostischer Untersuchung den jeweils mit PMMA versorgten Bandscheibenfächern zuordnen ließen. Sowohl in den konventionellen Röntgenaufnahmen als auch in der additional durchgeführten CT-Untersuchung (Knochenfenster) fanden sich bei diesen Patienten Lysesäume um die Kunststoffdübel sowie Retrospondylosen mit Einengung der jeweiligen Neuroforamina als Ausdruck einer segmentalen Instabilität, so daß von einer Unverträglichkeit der Patienten bzgl. des PMMA selbst oder des Lösungsvermittlers ausgegangen wurde (Chromallergie?). Teilweise waren die eingegossenen PMMA-Dübel auch zu groß, so daß einen knöcherne Umbauung verhindert wurde. Alle 12 oben genannten Patienten wurden revidiert und mit verschraubten Interponaten versorgt. Die präoperativ geklagten Nackenschmerzen waren nach den jeweiligen Revisions-Operationen schlagartig verschwunden. Auf Grund dieser Erfahrungen wird auf die Verwendung von PMMA seit einigen Jahren verzichtet.
Polyätherätherketon (PEEK): In einer kürzlich erschienenen Arbeit konnte gezeigt werden, daß bei Verwendung von PEEK-Cages ohne Füllung eine knöcherne Fusion lediglich in ca. 72% bildmorphologisch nachgewiesen werden konnte, ohne dass die Patient mit fehlender knöcherner Fusion sich klinisch von den Patienten mit bildmorphologisch nachgewiesener Fusion unterschieden hätten (Pechlivanis et al. 2011). Allerdings zeigte sich bei einigen Patienten der eigenen Serie, bei denen Fusionen der Halswirbelsäule mit PEEK durchgeführt wurde, Befunde, die denen ähnelten, wie sie im letzten Abschnitt genannt wurden, obschon mit geringerer Inzidenz. Auch hier zeigte sich den revidierten Patienten, dass die chronischen Nackenschmerzen rasch nach der Operation verschwunden bzw. sich deutlich gebessert hatten. Auch aus diesen Gründen werden nun Fusionen nicht mehr mit PEEK vorgenommen, sondern nur mehr Fusionen mit Bauteilen aus Titan vorgenommen.
Unerwünschte Ereignisse nach Zervikalen Bandscheibenprothesen: In einer aktuellen Übersichtsdarstellung zu unerwünschten postoperativen Ereignissen "Komplikationen") wurden

