
|
|
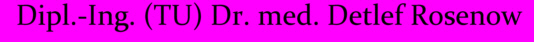
|
|
Lumbaler Bandscheibenvorfall
Die Folgen lumbaler Bandscheibenvorfälle als Krankheitssymptom wie z.B. die „Ischialgie“, sind seit Jahrhunderten bekannt. Vesalius beschrieb die Zwischenwirbel- oder Bandscheiben anatomisch. Die sog. „Ischialgie“ wird von Hippokrates erwähnt, obschon die Griechen unter der Bezeichnung „Ischialgie“ eine Reihe von Krankheitsbildern subsummierten. 1764 ordnete Cotugno die Ischialgie dem Nervus ischiadicus zu; weitere Beschreibungen der „Ischialgie“ erfolgten im 19. und frühen 20. Jahrhundert durch den serbischen Neurologen Laza Kuzman Lazarevic (1851–1890), dem französischen Epidemiologen, Internisten, Neurologen und Psychiater Ernest-Charles Lasègue (1816-1883) bzw. den Schweizer Neurologen Joseph Jules Dejerine (1849-1917) (Wilkins 1992). Vor allem im späten 19. Jahrhundert wurden die Folgen verletzungsbedingter Bandscheibenvorfälle der gesamten Wirbelsäule beschrieben (Schirmer & Hermes 2001), weil viele dieser Patienten an den Folgen der Traumen verstarben und eine Obduktion vorgenommen wurde. Kocher trennte die traumatischen von den spontanen Bandscheibenvorfällen: „Dagegen giebt es eine Läsion, welche hier Erwähnung finden muß. Das ist die wenig gewürdigte Kontusion und Zerquetschung der Zwischenwirbelscheiben. Als gleichzeitige Läsion mit Frakturen und Luxationen ist dieselbe häufig. "Es ist aber von besonderer Wichtigkeit, daß man diese Fälle von Zwischenwirbelläsionen als bloße Komplikation genau trennt von den seltenen Beobachtungen, wo dieselben isoliert vorkommen“ (Kocher 1896a, S. 418). Eine bis heute gebräuchliche klinische Untersuchungsmethode i.S. eines Dehnungszeichen der L5- und S1-Wurzel ist der sog. "Lasègue-Test", der jedoch nicht von dem Internisten Ernest-Charles Lasègue (1816-1883), sondern von seinem Doktoranden J.J. Forst in seiner Dissertation beschrieben wurde, so dass der eigentlich korrekte Ausdruck "Forst-Zeichen" sein müsste (Forst 1880, Wartenberg 1951, S. 58f., Wiltse 1997, S. 23f.). In der neurochirurgischen Praxis ist dieses Zeichen relativ unspezifisch, da auch andere Erkrankungen ein positives "Forst-Zeichen" ergeben können (z.B. Meningitis oder eine Subarachnoidalblutung). Vor allem Blockierungen des Kreuz-Darmbein-Gelenks , eine sehr häufige, sehr schmerzhafte Erkrankung durch unglückliches Verdrehen mit meist pseudoradikulärer Schmerzausstrahlung kann ein falsch-positives "Forst-Zeichen" ergeben. Auch Wurzelreizungen der L3- und L4-Wurzeln kann man mit dem sog. "umgekehrten" Lasègue-Test manchmal erheben. Hier gilt das Gleiche wie oben beschrieben: Es handelt sich um kein sonderlich spezifisches klinisches Zeichen in der neurochirurgischen Untersuchung.
Die ersten, eigentlichen Operationen an lumbalen Bandscheibenvorfällen wurden ab den frühen 1900er Jahren vorgenommen, wobei die Bandscheibenvorfälle noch „Ekchondrome“ oder „Enchondrome“ genannt wurden, also „Knorpeltumoren“. Die Höhenlokalisation zeigt gerade heute, wie unabdingbar eine exakte neurologische Untersuchung und Kenntnis der menschlichen Anatomie damals war und es heute noch sein sollte, aber oft nicht mehr ist, weil die moderne Schnittbildgebung die Wichtigkeit anatomischer Kenntnisse relativiert. Die Art der OP-Technik mutet aus heutiger Sicht nachgerade abenteuerlich an (Krause 1911): Makrochirurgisch, also mit bloßem Auge, wurde die Dura mater spinalis schlitzförmig eröffnet, den Liquor cerebrospinalis ließ man ablaufen, dann wurde der Intraduralraum inspiziert, danach die Vorderseite der Dura eröffnet, und danach der Bandscheibenvorfall entfernt. Die histopathologische Untersuchung durch Emil Heymann, Krauses späterem Nachfolger, ergab den Befund „Knorpelgewebe mit spärlichen Knorpelzellen“. Der postoperative Verlauf derart operierter Patienten war, problemlos nachvollziehbar, erheblich kompliziert. Der von Krause exemplarisch beschriebene Patient hatte sich aber so weit von der OP erholt, daß er 10 Monate nach der OP ein eingeschränkt normales Leben führen konnte. Zurück blieb eine Peroneusparese rechts, die allerdings auch schon vor der OP bestanden haben könnte (Krause 1911, S. 717-719).
Ein derartiges transdurales Vorgehen war bis Mitte der 1930er Jahre üblich. In der Literatur werden der Neurochirurg Mixter und der Orthopäde Barr als diejenigen genannt, die als erste lumbale Bandscheibenvorfälle, ebenfalls transdural, operiert haben (Mixter & Barr 1934). Im Juni 1934 hatte Joseph Seaton Barr (1901-1964) einen Patienten mit einem aus heutiger Sicht lumbalen Bandscheibenvorfall, der sich trotz 14tägiger konservativer Therapie klinisch nicht besserte. Barr stellte daraufhin diesen Patienten dem Neurochirurgen William Jason Mixter (1880-1958) vor, der bildmorphologisch mittels eines Lipiodol-Myelogramms eine Raumforderung sicherte und den Patienten auch selbst operierte. Das intraoperativ gewonnene Gewebe wurde histologisch untersucht. Barr hatte gerade das deutschsprachige Buch des deutschen Pathologen Christian Georg Schmorl (1861-1932) "Die Pathologie der Wirbelsäule" (1926) zur Buchbesprechung bekommen und fand darin qualitativ sehr gut gezeichnete Abbildungen von Bandscheibengewebe, glich diese mit dem "Tumorgewebe" ab, das Mixter bei seiner Operation gefunden hatte und stellte fest, dass es sich hierbei um Nucleus pulposus-Gewebe handelte (Wiltse 1997, S. 26f.). Zwar sind die Zeitabläufe dieses Zufallsbefundes sehr präzise bei Wiltse beschrieben, es lässt sich jedoch nicht daraus folgern, dass Mixter und Barr die Ersten waren, die einen lumbalem Bandscheibenvorfall erfolgreich operierten, wie auch jüngere Beiträge in der Literatur zeigen (Weinstein & Burchiel, 2009). Auch andere Neurochirurgen wie Walter Dandy oder Petit-Dutaillis haben, obschon zufällig, lockeres Knorpelgewebe als Ursache von entsprechenden klinischen Beschwerden beschrieben (Dandy 1929, Petit-Dutallis 1928, zit. Wilkins 1991, S. 503).
Die eigentliche Ursache der Bandscheibenvorfälle wurde schrittweise erst ab den ersten 1900er Jahren bekannt. Der in Boston tätige Orthopäde Joel E. Goldthwait postulierte, daß Bandscheibenvorfälle Ursache für Kompressionen der Cauda-equina-Fasern sein könnten, die sich klinisch als Rückenschmerzen und „Ischias“ darstellten (Goldthwait 1911, zit. Wilkins (1992), Seite 495). Ab den 1920er Jahren befaßten sich vor allem der in Dresden tätige Pathologe Georg Schmorl (1861-1932) und sein Schüler Junghans mit pathologischen Zuständen der Wirbelsäule. Klinische Beiträge kamen von verschiedenen Autorengruppen, so z.B. vom Charcot-Nachfolger am Hôpital Salpétrière Théophile Alajouanine (1890-1980) und dem Neurochirurgen Daniel Petit-Dutaillis (1889-1968) (Petit-Dutaillis & Alajouanine 1928 sowie Alajouanine & Petit-Dutaillis 1930) und von amerikanischen Arbeitsgruppen um Walter Dandy (Dandy 1929) und Max Minor Peet (Peet 1934). Diese Beiträge bestätigten letztlich Goldthwaits Hypothese.
Lumbale Spinalkanalstenose
Die Spinalkanalstenose als Ursache der Kompression der Rückenmarksfasern im lumbalen Spinalkanal wurde sehr viel früher als die einer Wurzelkompression durch einen lumbalen Bandscheibenvorfall erkannt. Cushing fand bei einem von ihm operierten Patienten „a narrowing of the osseous canal at the lumbosacral junction“, also eine Einengung des knöchernen (Spinal)kanals im lumbosakralen Übergang (Cushing 1911, zit. Benini 1986, S. 18). Die erste umfassende Monographie zu diesem Thema („Lomboartite e sciatica vertebrale. Saggio clinico“) stammt von dem italienischen Orthopäden Vittorio Putti (1880-1940), der der Leiter der damals bedeutendsten italienischen orthopädische Klinik, des Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, war (Putti 1936 , zit. Benini 1986, S. 19). Nach dem 2. Weltkrieg war es vor allem der Niederländer Henk Verbiest, der sich dem Thema der lumbalen Spinalkanalstenose umfassend widmete (s.u.).
Synovialzysten der lumbalen Wirbelgelenke
Eine gewisse Sonderstellung bei der Entstehung oder Verstärkung einer lumbalen Spinalkanalstenose nehmen Zysten der Wirbelgelenke ein. Wurde früher eher als Rarität über derartige intraspinale Pathologien berichtet, so ist dies nun zunehmend in der Fachliteratur der Fall (Kalevski 2014, S. 192). Aus eigener Beobachtung heraus sind Synovialzysten neben einer typischen ostoligamentären Kompression die wesentliche Ursache von radikulären Schmerzen bei Menschen aller Altersgruppen, vor allem aber findet man diese Zysten bei Patienten mit degenerativen Veränderungen. Christophis (2007) hat die verschiedenen Zystentypen histologisch untersucht (s.u.).
In der Bildgebung (MRT besser als CT) bereitet die Darstellung grosser, für die betroffene Lumbalwurzel raumfordernder Zysten keine Probleme (Ganglionzysten). Problematisch wird es , wenn diese Zysten ihren Flüssigkeitsgehalt verlieren und sich dann in der Bildgebung schwarz darstellen. Zysten nehmen dann im Laufe der jahre nicht selten eine kaugummiartige Struktur an, verkleben teilweise vollkommen mit den Wurzeltaschen oder der Dura, so dass die Entfernung dieser Zysten nicht selten mit einer Verletzung von Wurzeltasche oder Dura einhergehen, die dann eine plastische Deckung der Verletzungsstellen notwendig machen (vermutlich handelt es sich hierbei um Flavumzysten, also Pseudozysten (s. Christophis 2007). Derartige Komplikationen bleiben in den meisten Fällen für den Patienten folgenlos und lassen sich mit modernen Abdichtungsmethoden meist problemlos bewerkstelligen. Lässt man deratige Strukturen im Spinalkanal zurück, steigt mit der typischen postoperativen Vernarbung das Risiko des Wiederauftretens der ursprünglichen klinischen Beschwerden der Patienten. Das operative Ziel sollte die vollständige Entfernung aller auf die die betroffene Wurzel kompressiv wirkenden bindegwebigen Strukturen sein.
Diese Zysten entstehen aus der Gelenkskapsel der zygoapophysealen Gelenkskapsel lumbaler Wirbelgelenke. In der englischsprachigen Literatur werden diese Zysten auch kurz als "Juxtafecettenzysten" bezeichnet (Kao 1974). Dieser Terminus ist misnomer und wird zu recht kritisch gewürdigt (Christophis 2007). In Christophis´ Beitrag wird umfassend zu derartigen zystischen Strukturen Stellung bezogen, vor allem an Hand makroskopischer und mikropskopisch-histologischer Untersuchungen. Im wesentlichen fand Christophis am untersuchten Kollektiv (n=32) drei wesentliche Typen: Synovialzysten (mit typischer Auskleidungsmembran), Ganglionzysten (direkt aus einem Gelenkserguss entstehend) sowie Flavumzysten (Pseudozysten ohne membrane Auskleidung).
Derartige Zysten entstehen in den meisten Fällen aus den Gelenken des Segments LW 4/5, seltener aus den Gelenken LW 3/4 bzw. aus den Gelenken des lumbosakralen Segments. Zysten aus höher gelegenen Segmenten dürfen als Rarität betrachtet werden, vor allem solche im Bereich der unteren BWS, dann allerdings mit dem Risiko einer Rückenmarkskompression mit entsprechender Teilquerschnittssymptomatik. In der HWS treten deratigen Zysten noch seltener auf. Bei dem von Kao (Kao 1974) geschilderten Fall handelte es sich allerdings um einen 52-Jährigen Patienten mit einer Zyste des Wirbelgelenkes bei HW 6/7 links.
Die Entstehung deratiger Zysten ist unklar. Diskutiert wird die Entstehung deratiger Struturen als Folge von repetiven Mikrotraumen zusammen mit unphysiologischer Beweglichkeit des betroffenen Segments , die zur Ruptur der Synovialmembran, Herniierung von Synovialflüssigkeit und -zellen sowie zur Proliferation von mesenchymalen Zellen und myxoider Degeneration führt (Kalevski 2014, S. 192). In der Tat treten deratige Zysten mit Abstand am häufigsten im Segment LW 4/5 auf, welches biomechanisch die grösste segmentale Bewegungsrahmen der LWS aufweist und wo degenerative Spondylolisthesen am häufigsten auftreten.
Das Risiko von Zystenrezidiven ist aus eigener Erfahrung bei Synovialzysten gering und bei Flavumzysten fehlend, da das gelbe Band ja bei der dekompressiven OP resiziert wurde. Lediglich Ganglionzysten haben ein potentielles Rezidivrisko, da die spondylarthrotischen Veränderungen ja weiter bestehen und das Wirbelgelenk aus Stabilitätsgründen erhalten bleibt (es wird lediglich das mediale Drittel abgefräst und das Gelenk bleibt im Wesentlichen erhalten (s.a. Christophis 2007).
Pathoanatomie und -genese der lumbalen Spinalkanalstenose
Der lumbale Spinalkanal kann vereinfacht in einen zentralen und zwei seitliche Abschnitte unterteilt werden, die man Rezessus laterales (lat.: für Winkel, Falte, Nische) oder seitliche Wurzelkanäle nennt. Diese können, seltener, angeboren oder anlagebedingt (= primär) sein oder, wesentlich häufiger, als Folge altersbedingter und anderer Kofaktoren (Erbfaktoren (wesentlicher Faktor)), Genußgiftmißbrauch (vor allem Nikotin, Medikamente (z.B. Cortison) und bestimmter Getränke mit hohem Phosphatgehalt (z.B. Cola) sowie eiweißarme Ernährung) sekundär oder erworben sukzessiv einengen und dadurch symptomatisch werden. Rezessus lateralis-Stenosen treten insgesamt weitaus häufiger auf als zentrale Spinalkanalstenosen. Echte Rezessus gibt es in der Wirbelsäule aber meist erst unterhalb LWK 1, was erklärt, daß sich die klinischen Beschwerden sehr häufig den Wurzeln L4 bis S1 und sehr viel seltener höher gelegenen Wurzeln zuordnen lassen.
Auch die Länge der Rezessus laterales variiert zwischen 10-12 mm im Bereich der oberen LWS, ca. 2,5 cm für die mittlere LWS und 3 cm (LW 4/5) und bis 3,5 cm lumbosakral (Bose 1984). Der Spinalkanal kann sowohl in der Breite (innerer Bogenwurzelabstanz) als auch in der Höhe eingeengt sein. Bis zu 10 mm spricht man von einer absoluten, bis ca. 14 mm von einer relativen Stenose. Klinisch ist das irrelevant, weil sich aus der Einengung per se keine operative Indikation ergibt. Daraus folgt, daß, je enger die anatomischen Verhältnisse insgesamt sind, früher damit zu rechnen ist, daß sich degenerative Folgen bemerkbar machen (z.B. Bandscheibenvorwölbungen, degenerative Sinterungsprozesse (Bandscheibenverschmälerungen, Sinterung der Knochensubstanz der Wirbelkörper etc.), sie also zu Beschwerden führen.
(Neurogene) Claudicatio spinalis - Schaufensterkrankheit
Charcot beschrieb 1858 eine schmerzhafte Lähmung („paralysie douloureuses“) bei einem Patienten mit aneurysmatischem Verschluß einer A. iliaca primitiva (heute: communis) und nannte diese „claudication intermittente par oblitération artérielle“. Er erwähnte in seiner Beschreibung, daß derartige arterielle Gefäßverschlüsse bei Pferden lange bekannt waren und zitiert den Tierarzt M. Bouley, der 1831 in Paris bei Zugpferden mit vergleichbarer klinischer Symptomatik Verschlüsse der Arteriae femorales als Ursache für die Hinterlaufbeschwerden fand (Charcot 1858, zit. Benini, S 106). Charcots Beschreibung blieb Jahrzehnte unbeachtet, bis Leriche 1923 einen Verschluß der Aorta abdominalis vor der Gabelung in die Aa. iliacae communes als Ursache für Beinschmerzen, Taubheit und Impotenz beschrieb, ein Krankheitsbild, das heute „Leriche-Syndrom“ genannt wird. Erst um 1950 erfolgten die ersten Beschreibungen der neurogenen „Schaufensterkrankheit“ durch van Gelderen (1948) und Verbiest (1950). „Claudicatio“ ist lateinisch und bedeutet „Hinken“. Die Bezeichnung „Claudicatio intermittens“ ist semantisch unsinnig, da die Caudafasern nicht „hinken“ können. Die betroffenen Patienten hinken nicht, sie haben ein Schwächegefühl in den Beinen, weshalb sie nach relativ kurzer, schmerzhafter Gehstrecke stehenbleiben müssen. Von daher wäre die Bezeichnung „Debilitas“, lateinisch für „Schwäche, Ermattung“ zutreffender.
Altersphysiologische Veränderungen
Im Rahmen altersdegenerativer Veränderungen verlieren zunächst die Bandscheiben Flüssigkeit, sie bieten in der MRT das Zeichen des „black-disc-phenomenon“ (Bandscheiben stellen sich in der MRT schwarz dar). Durch den Flüssigkeitsverlust verlieren sie an Höhe. Der Annulus fibrosus wölbt sich am Rand der Bandscheiben hervor, die Wirbelgelenkskapseln verlieren an Spannung, die Wirbelgelenkknorpel degenerieren. Durch die Höhenminderung der Bandscheiben kommt es zu einer Überbelastung der Wirbelgelenke, woraus eine Wirbelarthrose, oder Spondylarthrose resultiert. Ferner sintern die Wirbelkörper, weil sich die Spongiosa (substantia spongiosa) der Wirbelkörper physiologisch osteopenisch verändert (Abnahme der Anzahl der Knochenbälkchen oder Trabekel). Da die Corticalis (substantia compacta) auf Grund einer anderen histoanatomischen Struktur (Osteone) eine dichtere Knochensubstanz bietet, resultiert hieraus eine Retrospondylose durch Vorwölbungen der Grund- und Deckplatte aneinander grenzender Wirbelkörper, unscharf auch als „harter Bandscheibenvorfall“ bezeichnet. Durch die Sinterung werden gleichzeitig die gelben Bänder gestaucht (gefältelt), so daß sie vertikal an Höhe zunehmen. Die Kombination aus Retrospondylose, Stauchung der gelben Bänder, Verplumpung der Wirbelgelenke engt die segmentalen Wurzelkanäle ein und führt zu einer Rezessus lateralis-Stenose oder Wurzelkanaleinengung (seitliche Spinalkanalstenose).
Aus allen oben aufgeführten pathophysiologischen Veränderungen resultiert zunächst eine übermäßige Beweglichkeit eines Wirbelsegments. Da der Körper diese unphysiologische Beweglichkeit als nicht normal erkennt, versucht er durch endogene Prozesse ein betroffenes Segment zu restabilisieren, indem die Wirbelgelenkskapseln fibrosieren und die Wirbelgelenke hypertrophieren (Entwicklung einer Spondylarthrose).
Die geschilderten altersphysiologischen Abläufe machen klar, daß eine Wurzelkanaleinengung umso früher symptomatisch wird, je enger die Wurzelkanäle und die zentralen Abschnitte des Spinalkanals sind. Wurzelkanalstenose (häufig) führen daher zu einer radikulären Symptomatik, wohingegen eine zentrale Spinalkanalstenose (seltener) zu einer fälschlicherweise „Claudicatio spinalis“ genannten Symptomatik führt (semantisch unsinnig, da Caudafasern nicht hinken können; auch die Patienten hinken nicht. Claudicatio: lat. „Hinken“). Sinnvoller wäre der Ausdruck Debilitas: lat. „Lähmung“, „Schwäche“, „Gebrechlichkeit“) (Verbiest 1984, Verbiest 1991).
Die oben beschriebenen altersphysiologischen Abläufe treffen weniger auf die HWS als auf die LWS zu, da die Wurzelkanäle in der HWS anatomisch fast horizontal verlaufen. In der HWS sind vor allem Retrospondylosen und Bandscheibenvorfälle für ventral bedingte radikuläre Symptome verantwortlich, wohingegen die Kombination (sog. aus ventraler und dorsaler Kompression mit zusätzlich relativ engem zervikalen Spinalkanal für sog. „zervikale Myelopathien“ verantwortlich, die bei Sturz des Patienten ohne Weiteres zu einem Querschnittssyndrom führen können (in der LWS gibt es kein Rückenmark mehr sondern nur Cauda-equina-Fasern; das Rückenmark endet in Höhe LWK 1 als Conus medullaris).
Degenerative (sekundäre) Instabilität der Lendenwirbelsäule
Der Begriff „Instabilität“ im Zusammenhang mit der Wirbelsäule ist ein unscharfer Begriff. Er bezeichnet eine übernormale Bewegungsstörung eines oder mehrerer aneinander grenzender Wirbelsäulensegmente.
Es existiert bis heute keine allgemein akzeptierte Definition des Begriffes „Instabilität“ mit Bezug auf die Wirbelsäule. Dennoch ist dieser Begriff als eigenständige Diagnose in die Literatur „gekrochen“ (Bogduk 2001, S. 215). Insbesondere ab Mitte der 1980er bis Ende der 1990er Jahre wurde zahlreich zum Thema „Instablität der LWS“ publiziert bzw. fanden Symposien zu diesem Thema statt, hauptsächlich im Fachgebiet der Orthopädie (Kirkcaldy-Willis 1983, Nachemson 1991). Der Fokus lag dabei im Bereich der LWS, so daß die wissenschaftlichen Publikationen auch sehr viel seltener die Instablität der HWS zum Thema hatten.
Eine „Instabilität“ liegt, um es zunächst vereinfacht zu definieren, dann vor, wenn eine pathophysiologische Störung eines Bewegungssegments vorliegt. Ursache können traumatischer Art sein (wird hier nicht weiter besprochen) oder meist Folgen altersdegenerativer Veränderungen der anatomischen Elemente eines (häufig) oder mehrerer Wirbelsäulen-Bewegungssegmente.
Spondylolisthesis und Pseudospondylolisthesis
Systematische pathologisch-anatomische Untersuchungen der Wirbelsäule wurden in Deutschland von dem Pathologen Georg Schmorl im Stadtkrankenhaus in Dresden-Friedrichstadt ab 1925 vorgenommen und zusammen mit seinem Mitarbeiter Herbert Junghanns 1932 veröffentlicht (Schmorl & Junghanns 1932).
Erste Untersuchungen über das Wirbelgleiten nahm allerdings bereits der deutschstämmige, in Warschau als Gynäkologe tätige Franciszek Ludwik Neugebauer (1856-1914) Ende der 1880er Jahren vor und fand Gebärenden eine Inzidenz von 5%, eine Zahl, die noch Jahrzehnte später als Größenordnung anhand von Skelett und Röntgen-Serienuntersuchungen bei Angehörigen der weißen Rasse ihre Gültigkeit behielt (Übersichtsdarstellung bei Hoeffken & Wolfers 1974, S. 78). Die bei Eskimos gefundene hohe Zahl von über 27% wurde als Folge von Inzucht gewertet.
Schmorl erkannte früh den Stellenwert der noch relativ jungen Röntgendiagnostik bei der Erkennung pathologischer Zustände der Wirbelsäule ist und stellte in seiner Monographie aus dem Jahr 1932 den makroskopischen Schnitten die jeweils korrespondierenden Röntgenbilder gegenüber. Erst wieder nach dem Krieg wurden in den 1950er Jahren wieder im großen Stil Röntgenserienuntersuchungen vorgenommen.
Spondylolisthesen, also Ventralverschiebungen zweier benachbarter Wirbelkörper gegeneinander, treten vor allem in der LWS und häufiger bei Frauen als bei Männern auf. Man unterscheidet das echte, angeborene, „primäre“ Wirbelgleiten (oder „Spondylolisthesis vera“) vom erworbenen, degenerativen, „sekundären“ Wirbelgleiten („Pseudospondylolisthesis“), beides Arten der Instabilität der LWS.
Adjacent level disease (ALD) (Anschlußinstabilität)
Durch seit den 1990er Jahren zunehmenden Zahlen an zervikalen, vor allem jedoch lumbalen Spondylodesen, erfolgten ab Ende der 1990er Jahre Beschreibungen von bildmorphologischen Kriterien degenerativer Veränderungen in Segmenten, die an die spondylodetisch versorgten Segmente angrenzten mit der möglichen Folge einer Hypermobilität (Instabilität) dieser angrenzenden Segmente (Übersichtsdarstellung bei Grochulla 2009). Generell ist anzumerken, daß bildmorphologische Veränderung nicht klinisch-symptomatische Veränderung bedeutet (s.o. Modic-Zeichen).
Wie oben beschrieben, erfolgen in der HWS bei degenerativen Erkrankungen überwiegend ventrale, in der LWS hingegen dorsolaterale Spondylodesen. Biomechanisch resultiert daraus bereits ein erheblicher Unterschied, da vordere Versteifungen die Beweglichkeit der segmentalen Wirbelgelenke bzw. die der angrenzenden Wirbelgelenke logischerweise deutlich weniger als die der hinteren Versteifung einschränkt, da diese die segmentale Wirbelgelenkbeweglichkeit vollständig aufhebt und die der angrenzenden logischerweise entsprechend erhöht. Diese biomechanischen Erwägungen könnten eine Erklärung dafür sein, daß die Inzidenz der ALD in der HWS deutlich unter der der LWS liegt.
In einem Übersichtsartikel wurden für die HWS ein (bildmorphologisches) Auftreten zwischen 9 und 17% gefunden, wobei die jährliche Inzidenz der Anschlußinstabilität lediglich zwischen 1,5 und 4% liegt (Hillibrand 2004, zit. Kallisvaart 2010). Andere Autoren fanden ein Jahr nach monosegmentaler zervikaler Spondylodese eine normale Beweglichkeit der Anschlußsegmente (Grochulla 2009, S. 400). Neuere Publikationen halten die Anschlußinstabilität für einen physiologischen Zustand, der durch eine Fusion nur beschleunigt. Auch wird mangels entsprechender qualitativ guter Datenlage die Frage gestellt, ob eine zervikale Bandscheibenprothese mit den (hier) an anderer Stelle beschriebenen theoretischen Vorteilen diese begrenzt oder gar aufhebt (Ponnapan 2008). Letztlich bestätigt diese Arbeit den experimentellen Charakter von Bandscheibenprothesen. In einer großen Serie von 900 Patienten, die sich an der HWS Revisionseingriffen im Zeitraum 1994-2000 unterzogen, wurden Zahlen zwischen 1 bis 1,5 % gefunden, wobei monokorpektomierte Patienten mit ausschließlich ventraler instrumentierter Spondylodese ("vordere Verschraubung") einen vergleichsweise hohen Prozentzahl von 5,6% aufwiesen, ohne daß dafür eine Erklärung gefunden worden wäre. Interessanterweise waren Patienten mit einer Multikorpektomie (über 2 entfernte und ersetzte Wirbelkörper) und rein dorsaler Spondylodese ("hintere Verschraubung") mit nur 1,5 % in dem Patientenkollektiv vertreten (Greiner-Perth 2009).
Für die LWS wurden deutlich höhere Zahlen gefunden. Anhand von Rechenmodellen fand Ghiselli Anschlußinstabilitäten, die eine operative Dekompression oder eine Verlängerungsspondylodese notwendig machten von 16.5% bei fünf Jahren bzw. 36.1% bei 10 Jahren, wobei er keine Korrelation zwischen der Fusionslänge und dem Ausmaß des präoperativen degenerativen Zustands der LWS fand (Ghiselli 2004). Kumar fand bei 83 untersuchten Patienten nach fünf Jahren in 36,1% der untersuchten Fälle radiologische Zeichen der Anschlußinstabilität von denen 16,8% operiert werden mußten (Kumar 2001, zit. Grochulla 2009, S. 399) , Brook bei 2345 untersuchten Fällen eine allgemeine Reoperationsrate von 20,1% (Brook 2007, zit. Grochulla 2009, S. 399).
In einer jüngeren Studie (Okuda et al. 2018), in der insgesamt 1000 Patienten (mittleres Patientenalter 67 Jahre, durchschnittlicher Follow-up 8,3 Jahre) wurden deutlich geringere Zahlen gefunden: Die Inzidenz der ALD mit Interventionsnotwendigkeit (gemeint: Erweiterungsspondylodese) betrug 9% innert eines Zeitraums von 4,7 Jahren, eine zweite Interventionsnotwenigkeit betrug 1,1% und eine dritte 0,4%. Als wesentlicher Faltur für das Auftreten einer ALD wurde die Fusionslänge gefunden, betroffen war vor allem das nach oben angrenzende fusionierte Segment, welches auch der eigenen Erfahrung entspricht.
"Mikroinstabilität"
Dieser Begriff soll der Vollständigkeit hier erwähnt werden. Er ist ein Misnomer. Unter "Mikroinstabilität" wird verstanden, daß chronische Rückenschmerzen, ein sehr häufiges Symptom von Patienten mit degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen, vor allem im Alter, daher rühren, daß sehr kleine segmentale Instabilitäten, die sich auch der Darstellbarkeit in der Bildgebung entziehen, die Ursache dieser Schmerzen seien. Als Therapie der Wahl wird dann oft eine „Versteifungsoperation“ als sinnvolle Therapie der Wahl empfohlen. Es gibt jedoch keine evidenzbasierte Daten, die die Sinnhaftigkeit dieses Eingriffes überhaupt zeigen. Manchmal werden von Ärzten die Modic-Kriterien in der MRT (s.u., Abschnitt „Bildgebung“) als Argumentationshilfe für das Vorliegen einer „Mikroinstabilität“ herangezogen. Das ist falsch und erhöht den Wahrheitsgehalt der Argumentation nicht. So findet er sich auch nicht in der relevanten internationalen Literatur, wohl aber, wenn man unter dem Stichwort "Mikroinstabilität" googelt. Die Inhalte dieser Diskussionsforen sprechen dann für sich.
Bildgebende Diagnostik
Der modernen Bildgebung in Form der MRT sowie der „MR-Myelographie“ (sog. RARE-Sequenzprotokolle) kommt bei der Diagnose „Lumbale Spinalkanalstenose“, „Wurzelkanalstenose“ oder „Lumbaler Bandscheibenvorfall“ eine entscheidende Bedeutung zu. Sie liefert, zusammen mit Anamnese der Patienten und dem jeweiligen körperlichen Untersuchungsbefund, oft eine sehr genaue Eingrenzung der betroffenen Wirbelsäulenabschnitte. Die CT hingegen kann eine derartige Eingrenzung nicht liefern. Sie hat heute nur in Ausnahmefällen eine diagnostische Bedeutung, z.B., wenn ein Patient Herzschrittmacherträger ist und daher bei ihm keine MR-Untersuchung durchgeführt werden kann, oder wenn allgemein nach heterotopen Ossifikationen gefragt wird (z.B. verkalktes hinteres Längsband, ossifizierte Bandscheibenprothesen). Die auch heute noch unter kurzstationären Bedingungen durchgeführte Myelographie, bei der Kontrastmittel in den Subarachnoidalraum eingebracht wird, hat auf Grund der MR-Myelographie heute an Bedeutung verloren, da sie meist im Vergleich zur MRT keine wesentlichen Zusatzinformationen bringt. Die MR-Myelographie ist ein Sequenzprotokoll, das von einer geräteeigenen Software vorgenommen wird und wurde 1984 in die Radiologie eingeführt (Hennig 1986). Mit MR-Geräten wie jenen der Firma Philips können bis heute keine sinnvoll verwertbaren MR-Myelographien dargestellt werden, da die Software dafür nicht zur Verfügung steht.
Modic-Zeichen: Modic (damals Cleveland (OH)) beschrieb 1988 in zwei Beiträgen die bildmorphologischen Veränderungen in der damals noch recht jungen Modalität der MRT (Modic 1988, Modic 1989). Seine erste Klassifikation war zweiteilig. Typ 1: Signalintensitätsreduktion in T1-Wichtung, Signalintensitätserhöhung in T2-Wichtung. Typ 2: Signalintensitätserhöhung in T1-Wichtung bzw. Signalaintensitätserhöhung oder Isointensität in T2-Wichtung. Später wurde dann ein dritter Typ hinzugefügt, der die Irreversibilität der Veränderungen zeigte.
In einer Verlaufsuntersuchung über die Dynamik von bildmorphologischen Veränderungen an lumbalen Endplatten in der MRT über knapp zwei Jahre konnte gezeigt werden, daß es keinen Automatismus bzgl. der dynamischen Entwicklung der Modic-Veränderungen der Endplatten hin zu Verschlechterungn gibt. Es wurden einerseits zwar Verschlechterungen hin zu Stadium 3 gefunden (n=3), andererseits aber auch Normalisierungen (n=2) bzw. Verbesserungen zu Modic 1 (n=4) und Befundkonstanzen im Stadium 2 (n=18) (Hutton 2011). Huttons Untersuchung zeigt, daß ein Modic-Zeichen lediglich als unspezifisches, bildmorphologisches Kriterium von lumbalen Endplattenveränderungen zu werten ist, aus der sich per se keine therapeutischen Maßnahmen (konservativ oder operativ) herleiten lassen (s. auch oben "Mikroinstabilität").
Bildgebung bei Instabilität bzw. Spondylolisthesis
Hier sind vor allem zwei Bildgebungsmodalitäten wichtig: Die konventionelle Rö-Diagnostik sowie die MRT. Die oben beschriebenen Ergebnisse Neugebauers waren insofern interessant, als das Röntgen zu dieser Zeit noch gar nicht existierte und er seine Befunde rein klinisch bei Gebärenden erhob.
Das bildmorphologische Korrelat der primären Spondylolisthesis ist die in vor allem in der Schrägaufnahme der LWS sichtbare Spaltbildung oder Lysezone der Pars interarticularis, die der Erstbeschreiber Lachapèle „le col du petit chien“) nannte (Lachapèle 1939, zit. Hoeffken 1974, S. 85). Vor allem in der angloamerikanischen Literatur wird dieses Zeichen „Scotty dog with collar“ genannt. Derartige Befunde findet man als Zufallsbefund bei 5-20% aller LWS-Röntgenaufnahmen (Greenberg 2010, S. 476). Am häufigsten findet man diese Spaltbildung in der Pars interarticularis LW 5 (83%, gefolgt von LW 4 (16%) und LW 3 (1%) (Heisel 2003, S. 547). Dieses Zeichen allein ist ohne Krankheitswert.
Das physiologische „Scotty dog sign“ ergibt sich hingegen aus den anatomischen Anteilen einer Seite eines lumbalen Wirbelsegments, wie sie in einer Röntgen-LWS-Schrägaufnahme zur Darstellung kommen und die an einen Scotchterrier erinnern.
Das bildmorphologische Korrelat der sekundären Spondylolisthesis kann ein mehr oder weniger ausgeprägter Ventralversatz meist zweier aneinandergrenzender Wirbelkörper (meist LWK 4 gegen 5 oder 5 gegen Os sacrum 1) sein, die oftmals im Stehen (konventionelle Rö-LWS) oder in Rückenlage (LWS-MRT) nicht zur Darstellung kommen und sich nicht selten erst nach dem Umlagern zur OP in Stufenlagerung zeigen, wenn der Oberkörper auf dem OP-Tisch lagert und das Abdomen frei hängt. Derartige bildmorphologische Befunde erklären allerdings sehr gut, warum es bei Patienten mit derartigen hypermobilen Segmenten zu symptomatischen Bandscheibenvorfällen oder Synovialzysten der Wirbelgelenke in diesen Segmenten kommt.
Vor allem in der seitlichen Rö-Nativdiagnostik mit Funktionsaufnahmen (hier vor allem segmentale Knickbildungen, Antero- oder Retrospondylosen (autologe Knochenanbauten als Ausdruck einer Pseudarthrose)) kann man instabile Hypermobilitäten oft sehr gut darstellen.
In der MRT finden sich pathologische, segmentale Auffälligkeiten, die nach dem Erstbeschreiber „Modic-Zeichen“ genannt werden (Modic 1989)):
• Modic 1: Knochenmarksödem in benachbarten Wirbelkörpern (aktiver Prozess)
• Modic 2: Umbau des Knochenmarks in Fettmark (beginnender, chronischer Umbauprozeß)
• Modic 3: Reaktive (erosive) Osteochrondrose (beendeter Umbauprozess)
Elektrophysiologische Hilfsdiagnostik
Die neurologisch-apparative Diagnostik (EMG, NLG) ist fast immer in der präoperativen Diagnostik entbehrlich, da sie keine Aussage zur Ätiologie der Beschwerden leisten kann, noch zur exakten segmentalen Diagnostik, sondern sie kann bestenfalls Aussagen zu Art und Ausmaß einer Nervenwurzelschädigung liefern. Patienten mit Nervenwurzelreizungen weisen aber keine Auffälligkeiten in der elektrophysiologischen Untersuchung auf (Vogel 1984). Lediglich wenn postoperativ z.B. eine Fußheber- und/oder -senkerschwäche vorliegt, kann ein erfahrener Elektrophysiologe ab etwa 14 Tagen nach dem vermuteten Ereignis zwischen einer Schädigung einer lumbalen Nervenwurzel oder einer peripheren Nervenläsion, z.B. in der Kniekehle (N. tibialis) oder dem Wadenbeinkopf (N. fibularis oder syn. peroneus communis), unterscheiden. Eine entsprechende klinische Untersuchung ergibt hier aber auch meist bereits eindeutige Hinweise und eine MRT mit Kontrastmittel kann hier sehr viel früher entsprechende Informationen liefern.
Sonderfall Polyneuropathie (PNP): Hier finden sich bei hochgradiger zentraler Spinalkanalstenose klinische und elektrophysiologische Hinweise. Klinisch findet sich bei vielen Patienten einen Pallhyp- oder anästhesie im Bereich der unteren Extremitäten, die von den untersuchenden Neurologen aber selten der Spinalkanalstenose zugeordnet wird. Der Befund lautet dann oft „Idiopathische Polyneuropathie“ mit einem diferentialdiagnostischen Angebot über typische Ursachen einer PNP (Alkoholmißbrauch, Chemotherapeutika, Bleivergiftung, Diabetes mellitus etc.). Da das neuroanatomische Korrelat der Pallhypästhesie eine Hinterstrangläsion (Faszikuli gracilis (Goll) und cuneatus (Burdach)) im Rückenmark ist und jede einzelne Caudafaser einen Rest dieser langen Bahnen beinhaltet, ist die PNP bei lumbaler Spinalkanalstenose logisch eigentlich nachvollziehbar.
Klinische Beschwerden
Die klinischen Angaben der Patienten sind, bei entsprechender Fragetechnik des Untersuchers, meist eindeutig und daher bereitet die Diagnose einer Spinalkanalstenose oder Wurzelkanalstenose kaum Schwierigkeiten. Zu beachten ist, daß der wesentliche Leidensdruck der Patienten durch die Schmerzen bestimmt wird, nicht durch Taubheitsgefühl oder Lähmungen, die zudem oftmals nicht wahrgenommen werden oder ihnen von den Betroffenen keine Bedeutung beigemessen wird. Gerade die beiden letztgenannten Symptome sind es aber, die die Dringlichkeit einer Operation bestimmen. Schmerzen stellen stets eine relative OP-Indikation dar, obschon konservative Therapiemaßnahmen meist ohne anhaltenden Erfolg bleiben.
Konservative Therapie bei zervikaler oder lumbaler Radikulopathie
Sowohl in Fernsehsendungen als auch in der Laienpresse wird in fast regelmäßigen Abständen die Notwendigkeit einer konservativen Therapie vor einer etwaigen Operation an der Wirbelsäule zunehmend thematisiert. Es drängt sich der Eindruck auf, dass derartige Sendungen oder Artikel von den Kostenträgern gefördert werden.
Seit den 1970er Jahren wurde von Wirbelsäulenchirurgen üblicherweise ein konservativer Therapiezeitraum von 6 Wochen gefordert bevor eine chirurgische Intervention bei unterschiedlichen pathologischen Zustände der Wirbelsäule, also z.B. Spinalkanalstenose, Bandscheibenvorfall etc. in Betracht gezogen wurde (Alentado 2014). Ausgenommen waren hierbei natürlich spinale Notfälle.
Wie ist aber nun die Datenlage? Gibt es Studien, die den heutigen qualitativen Kriterien an Studiendurchführungen genügen? Die Antwort ist im Grossen und Ganzen: nein. Ein aktueller Reviewbeitrag von insgesamt 5719 Studien im Zeitraum zwischen 1953 und 2013 mit der Frage nach dem optimalen Therapiemanagement bei zervikaler oder lumbaler Radikulopathie fand als Ergebnis, dass es nur wenige Studien gibt, deren Ergebnisse überhaupt geeignet sind, einen solchen "optimalen" konservativen Therapiezeitraum festzulegen. Evidenzbasierte Daten existieren zu diesem Thema jedenfalls nicht (Alentado 2014). Die Autoren stellen fast, dass allenfalls 4 bis 8 Wochen als konservativer Therapiezeitraum vor einer eventuellen Operation geeignet ist. Das gilt im Wesentlichen sowohl für zervikale als auch lumbale Radikulopathien.
Insofern sind Aussagen von Diener (Diener 2014) nicht haltbar, wonach "langfristig bei Patienten mit spinaler lumbaler Stenose zunächst ein konservativer Therapieansatz mit nicht-steroidalen Antirheumatika, Krankengymnastik und physikalischer Therapie am Erfolg versprechendsten" sei. Angesichts der oben gemachten Aussagen ist vor allem bei Patienten über dem 65. Lebensjahr zu beachten, dass die Gabe von nicht-steroidalen Anmtirheumatka mit erheblichen Gesundheitsrisiken verbunden ist. Immerhin ca. 22% älterer Patienten erleiden unter einer solchen Therapie Blutungen aus dem oberen magen-Darm-Trakt, an deren Folgen immerhin 10% versterben. Eine derartige konservative Therapie kann also allenfalls kurzfristig über wenige Wochen eine gewisse Linderung bringen. Unter Berücksitigung von Ergebnissen evidenzbasierter Studien stellen auch selektive COX-2-Antirheumatika keine sichere Therapiealternative dar; auch sie besitzen ein erhöhtes Blutungsrisko des Magen-Darm-Traktes, obschon geringer als bei unselektiven COX-2-Hemmern. Vor allem ist jedoch das kardiale Comorbiditätsrisiko erheblich erhöht. Langfristig ist allein schon aus biomechanischer Sicht die operative Sanierung der lumbalen Stenose die erfolgversprechendste Therapieform, vor allem angesichts der relativ geringen perioperativen Risiken.
In den oben genannten Sendungen bzw. Schriftbeiträgen wird zu derartigen Feststellungen nie Stellung bezogen. Das legt die Vermutung nahe, dass es manchen Vertretern von Arztgruppen, die nicht-operativ tätig sind, vor allem daran liegt, Patienten mittels teilweise sinnlosen konservativen Therapiemethoden aus wirtschaftlichen Gründen von einer Operation abzuhalten und die Patienten so an sich zu binden. Auch werden nicht selten sachlich nicht haltbare Argumente, wie z.B. ein hohes Querschnittsrisiko oder ein zu hohes Alter eines Patienten, vorgetragen.
Eine oft von Radiologen durchgeführte Technik ist die der Periradikulären Therapie (PRT), in der CT-gesteuert an zervikale oder lumbale Wurzel ein Gemisch aus einem Lokalanästhetikum und einem Cortisonpräparat gespritzt wird. Diese Technik ist insofern für Radiologen lukrativ, weil sie in Deutschland ausserhalb des Budgets abgerechnet werden kann. Die Gabe von Cortision ist nun praktisch beendet worden, seit seitens der Kassenärztlichen Vereinigung festgestelt wurde, dass die Cortisonpräparate nicht die Zulassung für diese Therapie besitzen; es handelt sich um ein sogenanntes "off-label-use". In einer kontrollierten Studie, die kürzlich im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, zeigten die Ergebnisse, dass "verglichen mit der alleinigen Gabe eines Lokalanästhetikums (Lidocain), die Mischung von Lidocain mit einem Glucocorticoid (Triamcinolon 60-120 mg, Betamethason 6-12 mg, Dexamethason 8-10 mg oder Methylprednisolon 60-120 mg) keinen oder nur einen minimalen Vorteil für die Patienten gegenüber der alleinigen Gabe des Lokalanästhetikums aufweist" (Friedly et al., 2014, zit. BackLetter 2014, 97). Für Deutschland bedeutet das, dass bei Komplikationen im Zusammenhang mit der Verabreichung dieser Corticoide ein ärztlicher Behandlungsfehler vorliegt, vor allem wegen des Einsatzes dieser Substanzen als "off-label-use". Da auch unverständlicherweise derartige Mischspitzen seitens Radiologen an Diabetikern verabreicht wurden mit der Folge teilweise massiv entgleister Blutzuckerwerte bei Patienten mit Diabetes mellitus, liegt eindeutig ein Behandlungsfehler vor.
In einem wissenschaftlichen Beitrag im British Medical Journal wurde in einer Doppelblind-Studie als Ergebnis gefunden, dass die sog. "PRT" im Vergleich zur Gabe der antikonvulsiv (Antiepileptikum) wirksamen Substanz Gabepentin nach einem bzw. drei Monaten keinen Unterschied in der Wirksamkeit bei Patienten mit lumbosakralen Schmerzen zeigt (Cohen 2015). Das bedeutet, dass die orale Therapie mit Gabapentin gleich wirksam ist wie die invasive. Hierdurch entfällt auch das Risiko eines spinalen Abszesses, dessen Folgen jedoch für den Betroffenen katastrophal sein können. Allerdings besitzt Gabapentin ein potentiell erhebliches unerwünschtes Arzneimittelwirkungspotential. kann Gabapentin Cohen hatte bereits in einem Übersichtsartikel bzgl. der Wirksamkeit von epiduraler, nicht-steroidaler Injektionstherapie im Vergleich zur nicht-epiduralen Injektionstherapie auf die qualitativ sehr schlechte Datenlage hingewiesen (Cohen 2013). Eine akzeptable Therapieevidenz lässt sich mithin für beide Injektionstherapieformen nicht herleiten.
Operative Therapie
Wie bereits oben für die HWS beschrieben, waren Eingriffe an der LWS „einfacher“ durchzuführen als der dorsale Zugang zur Halswirbelsäule, zumal es quasi anatomisch nahe lag, durch die relative kurze Distanz zum Spinalkanal, des Fehlens des Rückenmarks in der LWS und des Umstandes, dass die meisten pathologischen Zustände im Bereich der Lendenwirbelsäule operationstechnisch sehr gut von dorsal zu erreichen sind, diesen Zugang zu wählen.
Bis in die 1970er Jahre wurden Eingriffe an der LWS fast ausschließlich makrochirurgisch angegangen. Im Gegensatz zu Neurochirurgen operieren Orthopäden heute meist noch makrochirurgisch, welches bis auf lumbale Versteifungsoperationen inakzeptabel ist. Es erstaunt, dass die postoperativen Ergebnisse an n=60 Patienten, die sämtlich vom selben Operateur (Klinik für Orthopädie) operiert wurden, im Verlauf bis zu 12 Monaten keine besseren Ergebnisse bei der mikrochirurgischen gegenüber der makroskopischen Technik zeigten (Tullberg 1993).
Das widerspricht deutlich der eigenen Erfahrung. Neuere Untersuchungen stützen diese. Geiger et al. (2019) konnten zeigen, dass Patienten (n=102) die wegen einer lumbalen Spinalkanalstenose in mikrochirurgischer Technik nur dekomprimiert wurden (also ohne Fusion ("Versteifung")), sowohl im kurz- als langfristigen Follow-Up statistisch signifikante Besserung ihrer klinischen Symptomatik zeigten, und zwar sowohl hinsichtlich ihrer Beinschmerzen als auch der Rückenschmerzen. Auch bei Revisionseingriffen zeigten sich statistisch deutliche Besserungen in den klinischen Verläufen vor allem hinsichtlich der Beinschmerzen.
Mikrochirurgische OP-Technik
Die Vorteile der mikrochirurgischen OP-Technik liegen auf der Hand: Unter entsprechender Vergrößerung ist es möglich, wesentlich gewebsschonender zu operieren als es makrochirurgisch mit dem bloßen Auge oder pseudomikrochirurgisch mit der Lupenbrille gelingt, wobei für den Terminmus "mikrochirurgisch" sprachlich korrekter der Terminus „mesochirurgisch“ zu wählen wäre (s. Kapitel Mikrochirurgie).
Die mikroskopische OP-Technik wurde 1967 quasi Goldstandard in der Neurochirurgie. Bereits vorher haben vor allem HNO-Chirurgen das OP-Mikroskop für Zugänge zum inneren Gehörgang genutzt, z.B. House ab 1961 in Los Angeles (UCLA), USA und Wullstein in Würzburg. Bereits 1963 hatte jedoch der Neurochirurg Friedrich Loew das OP-Mikroskop in Homburg/Saar für Bandscheibenoperationen eingesetzt (Loew 2003). Leonard Malis, Mt. Sinai Hospital, New York, der nicht nur die bipolare Koagulation entwickelt hatte, ohne die heute gewebsschonendes Operieren undenkbar wäre, trug wesentlich dazu bei, daß die mikrochirurgische OP-Technik zum operativen Standard wurde. Weitere Protagonisten waren RMP Donaghy und der in Zürich damals noch unter Krayenbühl tätige M.G. Yasargil. Yasargil veröffentlichte zeitnah eine umfassende Monographie zu diesem Thema (Yasargil 1969) und berichtete unabhängig von Caspar über eine 1967 begonnene größere Serien mikrochirurgisch operierter lumbaler Bandscheibenvorfälle, die 1976 auf der 27. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie in Berlin publiziert wurde (Yasargil 1977) und (Caspar 1977).
Zur mikrochirurgischen OP-Technik mußten erst geeignete Instrumente entwickelt werden, mittels derer eine mikrochirurgische OP-Technik erst möglich wurde. Das gilt vor allem für intrakranielle Eingriffe oder solche am Rückenmark. Chirurgische Instrumente für „einfache“ Wirbelsäulen-OPs stammen hingegen noch oft noch aus den Anfangsjahren der makrochirurgischen Wirbelsäulenchirurgie in den 1930/40er Jahren, so z.B. die Faßzangen (Cushing, Spurling), die Wurzelhaken (Love) oder die Knochenstanzen (Kerrison) oder Wundsperrer (Williams). Wolfhard Caspar, Mitarbeiter von Loew, Homburg/Saar, hat umfassend zahlreiche Instrumente bzw. Instrumentensysteme entwickelt, ohne die moderne, mikrochirurgische, spinale Wirbelsäulenchirurgie heute nicht denkbar wäre.
OP-Technik des lumbalen Bandscheibenvorfalls bzw. der Spinalkanalstenose
Die OP-Technik des lumbalen Bandscheibenvorfalls hat sich im Prinzip seit den 1960er Jahren nicht verändert. Nach Abschieben der langstreckigen Rückenmuskulatur und sauberem Darstellen des Halbbogens des betroffenen Segmentes erfolgt ein Abtragen der unteren Anteile des Halbbogens, Darstellen des gelben Bandes, Abtragen desselben und schließlich Darstellen des Bandscheibenvorfalls und Entfernung desselben.
Im Gegensatz zur „einfachen“ Bandscheiben-OP hat sich die Technik der Dekompressionstechnik einer lumbalen Spinalkanalstenose wesentlich verändert. Wurde früher in makrochirurgischer Technik eine sog. „Laminektomie“ vorgenommen, ist heute das sog. „Undercutting“, also das Unterschneiden der Gegenseite in mikrochirurgischer Technik, operativer Standard, da hier das Risiko der Entwicklung einer iatrogenen, symptomatischen Instabilität theoretisch reduziert ist. Für diese OP-Technik ist eine motorgetriebene Knochenfräse unerläßlich. Diese OP-Technik wurde bei der Indikation „Lumbale Spinalkanalstenose“ erstmals von Poletti beschrieben (Poletti 1995), und größere Serien mit den Ergebnissen von Patienten, die mit der von Poletti beschriebenen OP-Technik wurden von verschiedenen Autorengruppen publiziert (u.a. Spetzger 1997a u. 1997b), die eigentliche OP-Technik des Undercuttings wurde jedoch früher von Yasargil bei der Entfernung einer thorakalen intraspinalen arteriovenösen Mißbildung beschrieben (Yasargil et al. 1984). Allerdings zeigt eine vergleichende Untersuchung (makrochirurgische Laminektomie gegen mikrochirurgische Laminektomie "Poletti-Technik"), dass im postoperativen Vergleich die Patienten, die mittels mikrochirurgischer Technik operiert wurden, bessere postoperative Ergebnisse im Sinne schnellerer Schmerzreduktion, schnellerer Erholung, besserer Mobilisation und einem geringerem Schmerzmittelverbrauch (hier: Opiode) (Mobbs 2014). Leider wurde in dieser Arbeit nicht untersucht, bei vielen Patienten nach der einer makrochuirurgischen "offenen" Laminektomie sich eine iatrogene Instabilität entwickelt. Auch wurde kein Vergleich intraoperativer Komplikationen, z.B. Verletzung der harten Hirnhaut (Dura) als häufigste, allerdings meist irrelevante Komplikation überhaupt, nicht Gegenstand der Untersuchung. An anderer Stelle wurde das Risiko der Entwicklung einer iatrogenen Instabilität untersucht (Pappas & Sonntag 1996): Bei lediglich 6 Patienten (n=6/206) musste im Rahmen eines Zweiteingriffs eine Stabilisierung vorgenommen werden, wobei sich auch kein Zusammenhang fand zwischen den dekomprimierten Segmenten und der Notwendigkeit einer Stabilisierung. Drei Patienten fielen in die Gruppe von zwei dekomprimierten Segmenten, weitere drei in die Gruppe mit vier dekomprimierten Segmenten. Aus diesen Ergebnissen ist klar zu folgern, dass es einerseits keine Indikation zu einer primären, quasi vorsorglichen Spondylodese gibt, andererseits stellt eine Laminektomie unverändert eine gültige Standard-OP-Technik dar. Die Gründe, dass eine Laminektomie relativ selten eine sekundäre Spondylodese nötig macht, geben Pappas und Sonntag (1996): Es werden lediglich die medialen, unteren Anteile eines Wirbelgelenkes entfernt werden und das Gelenk an sich erhalten bleibt.
Spondylodese der Lendenwirbelsäule
Unter Spondylodese versteht man allgemein eine operative Versteifung eines oder mehrerer Wirbelsäulensegmente. Ist diese "instrumentiert", wird die Versteifungsoperation mittels eingebrachter metallischer Implantate (rigider Bandscheibenersatz, Wirbelkörpersatz, Pedikelschrauben, Stangen etc.) vorgenommen. Als Werkstoff wird heute fast ausnahmslos Titan verwendet, als nicht-metallischer Werkstoff kommen auch Kunststoffe zur Anwendung (z.B. PEEK = Poly-ether-ether-ketone). Knochenzement spielt bei lumbalen Spondylodesen keine oder nur selten eine Rolle (z.B. bei Wirbelkörperaugmentation bei Osteopenie oder Osteoporose).
Wie oben bereits erwähnt, wird an dieser Stelle nur auf die degenerativen Veränderungen der Wirbelsäule eingegangen, nicht auf traumatische, entzündliche oder tumoröse Ursachen, die eine Spondylodese notwendig machen.
Fusionsoperation bei „degenerativer Bandscheibenerkrankung“ (degenerative disc disease): Die zahlenmäßig bei Weitem führende Indikation für die instrumentierte Spondylodese der LWS erfolgt unter der Diagnose „Degenerative Bandscheibenerkrankung“ (engl.: degenerative disc disease) mit Mikroinstabilität (nicht sichtbar) oder auch Makroinstabilität (Meyerding-Klassifikation I-IV, s. primäre oder sekundäre Spondylolisthesis, weiter oben).
Ähnlich wie bei den Diagnosen „Mikroinstabilität“, „Failed back surgery“ handelt es sich auch bei der „degenerative disc disease“ wohl nur um eine Pseudodiagnose. Eine umfassende Literaturrecherche konnte jedenfalls nicht das Gegenteil belegen (BackLetter, 2010). Daraus ist zu folgern, daß lumbale Fusionsoperationen unter Diagnosen erfolgen, die sich wissenschaftlich nicht nachvollziehen lassen.
Sowohl die Anzahl der lumbalen Fusionsoperationen als auch die damit verbundenen Kosten sind in den USA nachgerade explodiert. Seit Ende der 1990er Jahren mit Hinsicht auf die „Spinal fusion surgery“ ein regelrechter medizintechnischer Boom in der Entwicklung von Fusionssystemen entwickelt hat.
In der Zeitschrift The BackLetter®, eine vollständig werbefreie wissenschaftliche Zeitschrift aus den USA, die 2011 im 26. Jahrgang erscheint, wird seit Jahren kritisch auf die explosionsartige Entwicklung dieser Fusionsoperationen hingewiesen. Demnach hat die Anzahl komplexer Fusionsoperationen zwischen 2002 und 2007 15-fach von 1,3 auf 19,9 pro 100.000 lumbaler Wirbelsäulenoperationen zugenommen (BackLetter 2010b).
Im Gegensatz zu den oben genannten Zahlen handelte es sich bei der rein dekompressiven, vor allem mikrochirurgisch durchgeführten Operation lumbaler Spinalkanalstenosen im Zeitraum 1980-2000 um die Operation mit den höchsten Zuwachsraten. Im Gegensatz zu den lumbalen Fusionsoperationen findet sich ein entsprechender wissenschaftlicher Niederschlag in randomisierten und kontrollierten Studien (Malmivaara et al. 2007) sowie Beobachtungsstudien (Weinstein et al. 2008, zit. BackLetter 2010b, S. 61).
Mit keiner einzigen wissenschaftlich akzeptablen Studie konnte bislang die Überlegenheit lumbaler Fusionsoperationen gegenüber rein mikrochirurgisch-dekompressiven Operationen bei lumbaler Spinalkanalstenose gezeigt werden. Volkswirtschaftlich handelt es sich also bei lumbalen Fusionsoperationen um Eingriffe, die kostenbezogen nicht akzeptabel sind. Es erscheint unvorstellbar, daß die Kostenträger (Krankenkassen) daraus in absehbarer Zeit nicht die Konsequenzen ziehen werden.
Das nun zu diesem Thema befragte Vertreter der entsprechenden chirurgischen Fachgesellschaften in den USA diese Entwicklung völlig anders sehen, überrascht kaum (BackLetter 2011, S. 25). „Man darf den Frosch nicht fragen, wenn man den Sumpf trocken legen möchte“, oder „Don´t ask the turkey for Christmas“ (amerikanisches Sprichwort).
Gesicherte Indikation zur Spondylodese
Hierbei handelt es sich um Patienten, die auf der oben beschriebenen degenerativen Veränderungen einen sog. „Instabilitätsschmerz“ haben oder wenn unerfahrene Operateure die Bogenwurzeln von Wirbeln oder über 50% der Wirbelgelenke abgefräst oder anders entfernt haben. Dieser instabilitätsschmerz wird von den Patienten als „vernichtend“ angegeben, sie haben das Gefühl, als ob sie „abbrechen“. Der Leidensdruck bei diesen Patienten ist extrem. Dieser Schmerzzustände ist in jeder denkbaren Körperposition vorhanden. In der konventionellen Röntgendiagnostik sieht man dann das Ausmaß des „Abrutschens“ eines betroffenen Wirbelsegments.
Derartige Patienten sind nach einer posterolateralen oder ventroposterolateralen Spondylodese schlagartig beschwerdefrei, im Gegensatz zu Patienten, die unter der Diagnose „Mikroinstabilität“ oder „Degenerativer Bandscheibenerkrankung“ versteift wurden, die nicht schlagartig beschwerdefrei sind.
Generell besteht bei spondylodetisch versorgten Patienten das Risiko eines „adjacent level disease“, also einer sog. „Anschlußinstabilität“, da das oder die an die versteiften Segmente angrenzen Segmente unphysiologisch belastet werden und ebenfalls hypermobil werden, woraus nicht selten Bandscheibenvorfälle der betroffenen Segmente herrühren. Es sind Kliniken bekannt, in denen unkritisch Versteifungen vorgenommen werden (unter den typischen oben genannten Pseudodiagnosen- und -indikationen), und bei denen bis zu 40% aller Patienten pro Jahr mit einer sog. „Verlängerungsspondylodese“ versorgt werden, bei denen also die Spondylodese nach oben oder unten verlängert wird.
Lumbale Bandscheibenprothese
Um nun den oben aufgezeigten, grundsätzlichen Nachteilen der iatrogenen Aufhebung der segmentalen Beweglichkeit entgegenzuwirken, entwickelte man sowohl für die HWS als auch LWS sog. „Bandscheibenprothesen“, die die altersphysiologische segmentale Beweglichkeit erhalten sollten. Hierzu wurden wiederum in Zusammenarbeit mit Klinikern seitens der medizintechnischen Industrie verschiedene Modelle entwickelt, die hier nicht näher besprochen werden sollen. Die Kosten liegen dabei in der Größenordnung von ca. € 2.500 – 3.500,-- und werden von den Kassen nicht getragen, d.h., die Kosten müssen vom Leistungserbringer (Kliniken) getragen werden, reduzieren also den Nettogewinn einer derartigen OP also erheblich.
Dem logisch nachvollziehbaren biomechanischen Denkansatz, daß die segmentale Mobilität mittels dieser Technik erhalten bleibt und die üblichen biomechanischen und klinischen Nachteile der Spondylodese somit vermieden werden, fehlt bislang jeglicher wissenschaftlicher Nachweis der Langzeitwirksamkeit gegenüber der konventionellen mikrochirurgischen Bandscheibenoperation oder allgemein der mikrochirurgischen Dekompression ohne Fusion, die jeweils operative Standardtechniken darstellen (BackLetter 2010c, Gravius 2007, Kallisvaart 2010), so daß diese OP-Techniken sowohl für die HWS als auch die LWS derzeit eine rein experimentelle chirurgische Technik darstellen, über die die Patienten entsprechend aufgeklärt werden müssen.
Lumbale Wirbelgelenkprothese
Bei derartigen Gelenkprothesen handelt es sich um eine Subkategorie dorsaler, dynamischer Stabilsierungsimplantate. Sie haben das Ziel, die Biomechanik eines Wirbelsegments zu erhalten. Sie sind potentiell indiziert bei:
• Biomechanischer Restoration eines Wirbelsegments oder (FSU) z.B. nach iatrogener Instabilität
• Kombination mit anderen, (theroretisch) bewegungsfunktionserhaltenen Implantaten (Bandscheibenprothese)
• Vermeidung von Anschlußinstabilitäten (s.u.)
• Gelenkersatz bei erheblicher Spondylarthrose
Derzeit werden in den USA vier FDA-Studien zum Beleg der klinischen Wirksamkeit durchgeführt (Wang 2011, S. 5). Es handelt sich also derzeit um eine reine chirurgisch-experimentelle, nicht-validierte OP-Technik. Langzeitergebnisse von kontrollierten Studien nach den Kriterien der evidenzbasierten Medizin werden den Stellenwert dieser neuen OP-Technik zeigen.
Operative Risiken bei dekompressiven Operationen der Lendenwirbelsäule
Die operativen Risksiken derartiger operativer Eingriffe können als generell generell "gering" eingestuft werden. Die Angst mancher Patienten vor einem derartigen Eingriff, die nicht selten von nur konservativ tätigen Ärzten geschürt, sind verantwortungslos, da sie bei Patienten Angst schüren, die allein auf Grund sowohl anatomischer als auch sachlicher Fakten nicht haltbar sind. Man hat gelegentlich den Eindruck, dass konservativ tätige Ärzte sich vornehmlich darum sorgen, nach einer Operation einen lukrativen "Dauerpatienten" zu verlieren. Auch die Aussage mancher Radiologen, die auf Grund eines bildmorphologischen Befundes konstatieren: "Das muss man versteifen", spricht nicht gerade für einen akzeptablen Kenntnisstand der wissenschaftlichen Literatur.
Die nachfolgende Listung der operativen Risiken wurden sämtlich einer Standardmonographie entnommen (Grumme & Kolodziejczyk 1994):
Querschnittsrisko
Fehlend, da das Rückenmark in Höhe von LWK 1 (Stand des Conus medullaris) endet. Allenfalls kann es eine Cauda-equina-Läsion geben durch Kompression der Rückenmarksfasern (der Cauda equina). Risiko: 0,07-0,3%
Wurzelverletzung
Risiko: 0,02% (Wood 1974, zit. Grumme 1994, S. 177) bis 3% Falconer 1948 (zit. Grumme 1994, S. 177)
Duraverletzung (Verletzung der harten Hirnhaut)
Risiko: 0,3% (Twerdy 1978, zit. Grumme 1994 S. 176) bis 6,7% (Caspar 1990, zit. Grumme 1994, S. 176). Derartige Verletzungen bleiben meist folgenlos, bedingen aber, dass das Duraleck adäquat verschlossen werden muss, sei es durch eine sog. primäre Duranaht oder, wenn die Duraverletzung zu großflächig oder die Dura mater spinalis zu dünn ist, durch entsprechendes Verschlussmaterial (z.B. Tachosil).
Epidurale Nachblutung
Derartige Komplikationen sind fast immer arterielle, da venöse Blutungen aus Plexusvenen meist von selbst sistieren. Derartige arterielle Blutungen entstehen meist aus Arterien der paraspinalen Muskulatur und treten meist zeitverzögert ca. 2 Stunden nach dem operativen Eingriff auf (anatomische Gründe). Derartige Hämatome führen meist zu heftigen radikulären Schmerzen, die wegen deren Intensität einen Revisionseingriff notwendig machen. Wurde jedoch intraoperativ die Dura verletzt und der Duraschlauch ist kollabiert, kann theoretisch eine Cauda-equina-Läsion auftreten, die selbstverständlich unverzüglich im Rahmen eines Revisionseingriff behoben werden muss. Risiko: 0,04% (Schirmer 1988, zit. Grumme 1994, S. 178) bis 11,6% (Söderberg 1958, zit. Grumme 1994, S. 178). Die erstgenannte Zahl entspricht am ehesten der heutigen Realität. Die eigenen Zahlen liegen bei ca. 0,002%.
Wundheilungsstörungen/Spinaler Abszess
Dieses Risko ist ebenfalsl als gering anzusehen: Wesentliche Ursachen sind lange OP-Dauer (über zwei Stunden), Diabetes mellitus, Übergewicht mit einem BMI über 40%, Nikotinmissbrauch, Immunsuppression und fehlende präoperative Antibiose, sog. "single-shot"-Antibiose (Risiko ohne Antibiose: 3,5%, mit Antibiose 0,5% (Geraghty 1984, zit. Grumme 1994 , S. 124). das Risisko der Entwicklung eines spinalen Abszesses liegen bei ca. 0,001 (Diabetiker Typ IIb und BMI über 40%)
Einfluss der operativen Erfahrung
Diese Einflussgrösse wurde von Pechlivanis an Patienten, die in einer universitären neurochirurgischen Einrichtung operiert wurden, untersucht. Im Ergebnis zeigte sich, dass die Komplikationsrate nicht linear mit der Erfahrung des Operateurs abnimmt. Sie ist am höchsten zwischen dem dritten und sechsten, also letzten, Ausbildungsjahr eines Operateurs (Pechlivanis 2009). Das deckt sich mit dem, was während der eigenen Ausbildungszeit galt: Bis zu ungefähr 100 operierten lumbalen Bandscheiben nahm die Komplikationsrate ab (Lernkurve), um danach wieder etwas anzusteigen und nach dem Ende der Facharztausbildung (6 Jahre) wieder sukzessive abzunehmen.